Zur Vorbereitung auf den oe-tag 2025 am 13. Juni 2025 in Halle (Saale), an dem wir uns auf dialogische Spurensuche zur deutsch-deutschen Geschichte in Organisationen begeben wollen, weil wir finden es ist “Noch längst nicht alles gesagt!” habe ich gelesen. Unter anderem über “Drei ostdeutsche Frauen, die sich betrinken und einen idealen Staat gründen” und auch Steffen Maus “Ungleich vereint – Warum der Osten anders bleibt”.
Einer der wahrscheinlich am häufigsten zitierten Sätze aus Maus Buch ist “Wer in der Ost-West-Debatte mit Schuldbegriffen operiert, ist schon auf dem Holzweg.“ Und genau deswegen ist uns der Dialog am oe-tag 2025 so wichtig, weil wir überzeugt sind, dass Schuld nicht nur in der “Ost-West-Debatte” auf den Holzweg führt, sondern eigentlich immer.
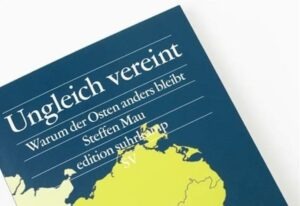 In unserer zunehmend diversen und komplexen Gesellschaft stellt sich uns als Prozessbegleiter:innen in der Organisationsentwicklung immer wieder die eine zentrale Frage: Wie gelingt Zusammenarbeit – in der Gesellschaft, aber auch ganz konkret in Organisationen?
In unserer zunehmend diversen und komplexen Gesellschaft stellt sich uns als Prozessbegleiter:innen in der Organisationsentwicklung immer wieder die eine zentrale Frage: Wie gelingt Zusammenarbeit – in der Gesellschaft, aber auch ganz konkret in Organisationen?
Steffen Mau liefert dazu eindrucksvolle Ansätze: Er zeigt, wie tief soziale Differenzierung in unsere Lebenswelten eingreift – und wie sich diese Unterschiede unmittelbar auf unser Miteinander auswirken. Besonders relevant dabei: die tief verwurzelte Ost-West-Differenz in Deutschland, die nicht nur gesamtgesellschaftlich, sondern auch in der Arbeitswelt unterschätzt wird.
Mehr als oben und unten: Gesellschaftliche Differenzierung neu gedacht
Mau geht über klassische Ungleichheitsnarrative hinaus. Ihn interessiert nicht allein der Gegensatz zwischen Arm und Reich oder Macht und Ohnmacht – sondern die vielen, oft subtilen Bruchlinien, die unsere Gesellschaft durchziehen: Bildung, Wohnort, Lebensstil, Mobilitätschancen, aber eben auch historische Prägungen wie die DDR-Sozialisation im Osten Deutschlands gehören dazu.
Diese Differenzlinien erzeugen keine glatten, einfachen Trennungen, sondern komplexe soziale Landkarten. In Organisationen bedeutet das: Unterschiedliche Erfahrungshorizonte, Werthaltungen und Erwartungshaltungen treffen aufeinander – nur manchmal sichtbar, und immer latent wirksam.
Ost trifft West: Eine unterschätzte Konfliktlinie in Organisationen
Besonders eindrücklich behandelt Mau die dauerhafte Prägekraft der DDR-Erfahrung – und deren Nachwirkungen bis heute. Über drei Jahrzehnte nach der “Wiedervereinigung” bestehen kulturelle und soziale Unterschiede fort, die in Organisationen hochrelevant sind.
Die westliche Sozialisierung und Prägung wurde 1990 zur Norm erhoben und führte so dazu, dass viele ostdeutsch sozialisierte Menschen plötzlich “anders” sind, so Mau: Sie sind in einem System aufgewachsen, das “andere” Normen, eine “andere” Arbeitskultur, ein “anderes” Verhältnis zu Autorität und Hierarchie vermittelt hat. Nach 1990 wurden diese Prägungen entwertet oder unsichtbar gemacht – sowohl im gesellschaftlichen Diskurs als auch in betrieblichen Strukturen.
In Organisationen führt das bis heute zu Missverständnissen, unausgesprochenen Spannungen oder unterschwelligen Statuskonflikten. Ostdeutsche Mitarbeitende berichten nicht selten davon, sich „übersehen“, „nicht ernst genommen“ oder „kulturell fremd“ zu fühlen – selbst dann, wenn sie längst “vollständig integriert” erscheinen, oder nach 1990 geboren wurden. Die soziale Gleichheit, die im DDR-System propagiert wurde, trifft hier auch heute noch auf westlich geprägte Leistungsideale, Selbstvermarktungsdruck und hierarchische Systeme der Anerkennung.
Steffen Mau spricht in diesem Zusammenhang von einer „Asymmetrie der Sichtbarkeit“: Ostdeutsche Erfahrungen sind in Führungspositionen und Leitbildern deutscher Organisationen unterrepräsentiert. Diese Form der strukturellen Nichtbeachtung wirkt sich direkt auf die Zusammenarbeit in Teams aus – denn wie gut man miteinander kooperiert, hängt auch davon ab, ob unterschiedliche Perspektiven überhaupt einen Platz bekommen.
Zusammenarbeit unter Bedingungen sozialer Differenz
Was bedeutet das nun für die Teamarbeit? Erstens: Diversität hat eine weitere Dimension: innerdeutsche Unterschiede – wie Ost- und West-Sozialisierungen – sind bedeutsam. Wer in einem Team führen oder arbeiten will, muss sich dieser Unterschiede bewusst sein. Es braucht Sensibilität für unterschiedliche Kommunikationsstile, Autoritätsverständnisse, Rollenbilder und biografische Erfahrungen.
Zweitens: Organisationen müssen immer noch lernen, Differenz nicht als Störung, sondern als Ressource zu verstehen. Auch Mau argumentiert hier, dass soziale Kohäsion nicht durch Uniformität entsteht, sondern durch das Anerkennen und Gestalten von Unterschieden. Gerade Ost-West-Erfahrungen bergen enormes Potenzial – etwa in Form von Resilienz, Improvisationstalent oder Teamorientierung auf der einen, und Innovations- und Wettbewerbsorientierung auf der anderen Seite.
Drittens: Es braucht aktive Anerkennung. Viele ostdeutsche Beschäftigte tragen das Gefühl mit sich, ihre Lebensleistung werde weniger geschätzt. In Teams und Organisationen kann das zu Rückzug, stillem Protest oder auch Misstrauen führen. Eine offene Gesprächskultur, in der biografische Prägungen thematisiert werden dürfen, ist daher essenziell für funktionierende Zusammenarbeit.
Status, Anerkennung und die unterschätzte Macht symbolischer Unterschiede
Mau betont außerdem: In modernen Organisationen geht es nicht nur um materielle Gerechtigkeit – sondern um Anerkennung. Wer wird gesehen? Wessen Perspektive zählt? Wer definiert die „normale“ Art zu arbeiten, zu kommunizieren, zu führen?
Gerade Ostdeutsche erleben oft eine doppelte Unsichtbarkeit: Einerseits wegen ihrer regionalen Herkunft, andererseits, weil sie in westlich geprägten Organisationen mit Codes, Netzwerken und Selbstverständnissen konfrontiert sind, die andere Prägungen haben als die, in den sie aufgewachsen sind oder in denen sie sich permanent anpassen müssen. Dies führt nicht selten zu stillen Loyalitätskonflikten oder Distanzierungsmechanismen – auch innerhalb von Teams.
Die Zukunft: Polarisierung, Diversität und eine neue Anerkennungskultur
Maus Buch verweist auf tiefere gesellschaftliche Trends, die Organisationen in Zukunft noch stärker herausfordern werden. Neben der digitalen Transformation und globaler Migration ist es für uns in Deutschland vor allem die Persistenz innerdeutscher Differenzlinien, die ernst genommen werden muss. Nur wer sich als Organisation fragt, wer fehlt, wer schweigt und wessen Perspektive strukturell unterrepräsentiert ist, wird eine inklusive und zukunftsfähige Arbeitskultur entwickeln.
Es braucht ein echtes Verständnis für die soziale Tiefenstruktur von Zusammenarbeit – und die Bereitschaft, auch unbequeme historische Unterschiede nicht nur zu benennen, sondern in positive Entwicklung zu überführen.
Fazit: Einheit in Vielfalt braucht Anerkennung
Ungleich vereint – warum der Osten anders bleibt ist ein wichtiges Buch für alle, die auch 35 Jahre nach der “Wiedervereinigung” finden, dass die innerdeutsche Ost-West-Thematik kein Anachronismus ist, sondern eine reale Kraft in der sozialen Architektur vieler Organisationen. Steffen Mau zeigt, dass Differenz kein Hindernis, sondern ein Gestaltungsspielraum ist.
Wer die Zusammenarbeit der Zukunft gestalten will, muss über klassische Diversitätskategorien hinausdenken. Es geht um biografische Gerechtigkeit, symbolische Anerkennung und die Bereitschaft, neue Formen der Einheit zuzulassen – eine Einheit, die nicht auf Gleichheit basiert, sondern auf respektvoller Differenz.

- Suhrkamp Verlag
- Erscheinungstermin : 17. Juni 2024
- Seitenzahl der Print-Ausgabe : 168 Seiten
- ISBN: 978-3518029893
- 18,00 €uro




