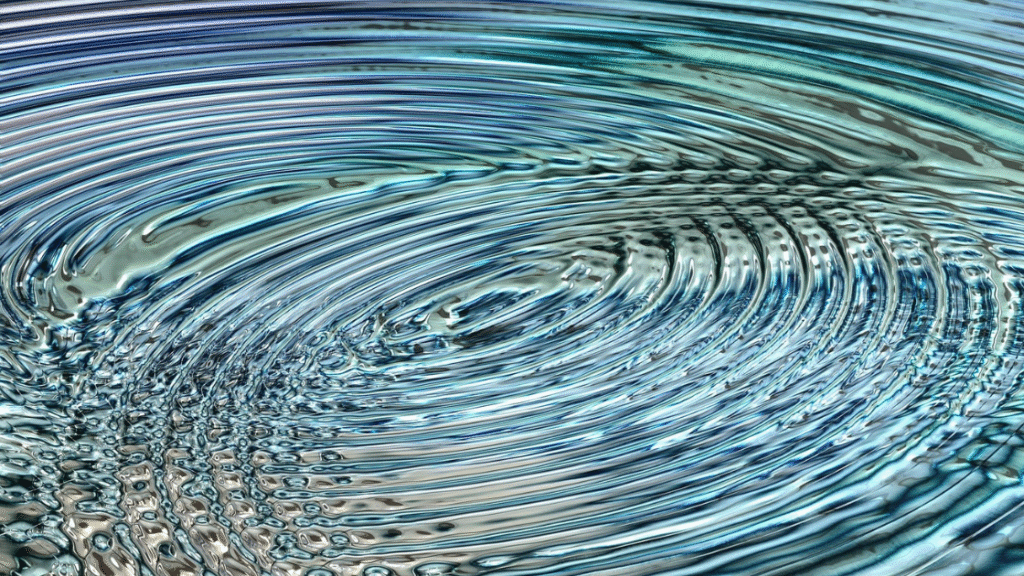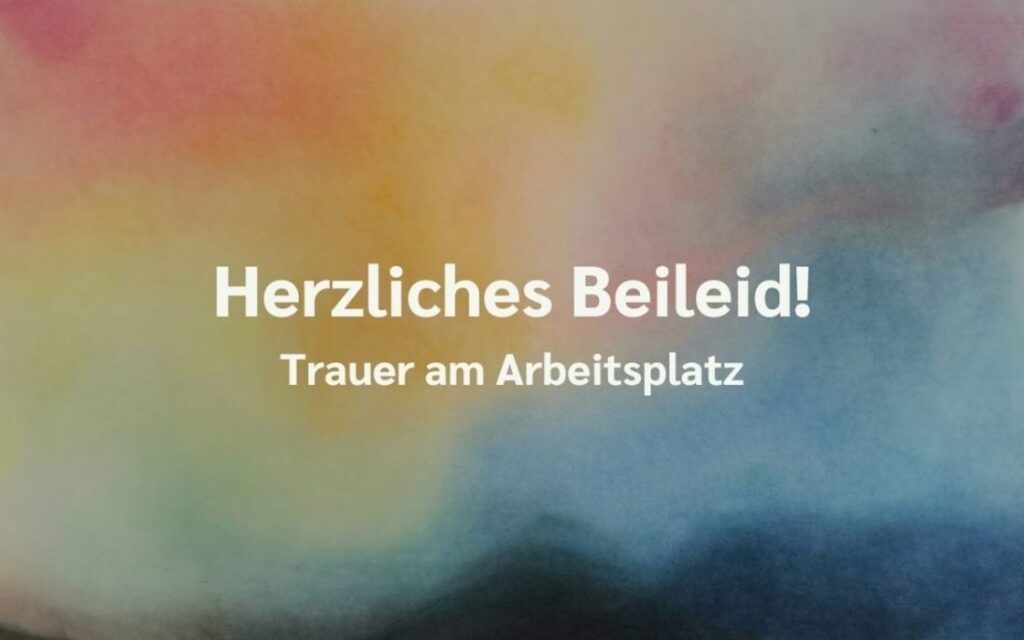Mit der Entstehung dieses Buches ist es wie mit der Gründung einer Schule gewesen – wir brauchten Geduld, Ausdauer und langen Atem. Wir hatten mit einigen...
Wir haben nichts anderes beseitigt als das blinde, irrational autoritäre Gehabe, das sich produktivitätsmindernd auswirkt. Mit diesem Zitat beschreibt Ricardo...
Schon vor vielen Jahren lernte ich bei Matthias zur Bonsens Lernforum in Oberursel Ines Boban kennen, eine Expertin in Sachen Inklusion. Damals wirkte sie mit ihrem...
Sechs waren angemeldet, fünf sind gekommen. Nach einer Vorstellungsrunde begannen wir mit einer kurzen Spekulation: Wieso sind denn nur so wenige hier? So ein...
Am 13. Oktober 2022 waren Nicola Kriesel, Lysan Escher und Andreas Knoth bei der „Every voice matters“ online Konferenz von Sociocracy For All und haben über unseren...
Diversitäts-und Diskriminierungsensibilität muss Hand in Hand gehen mit einem machtkritischen Diskurs in Organisation. Darin waren sich die 15 Teilnehmenden des...