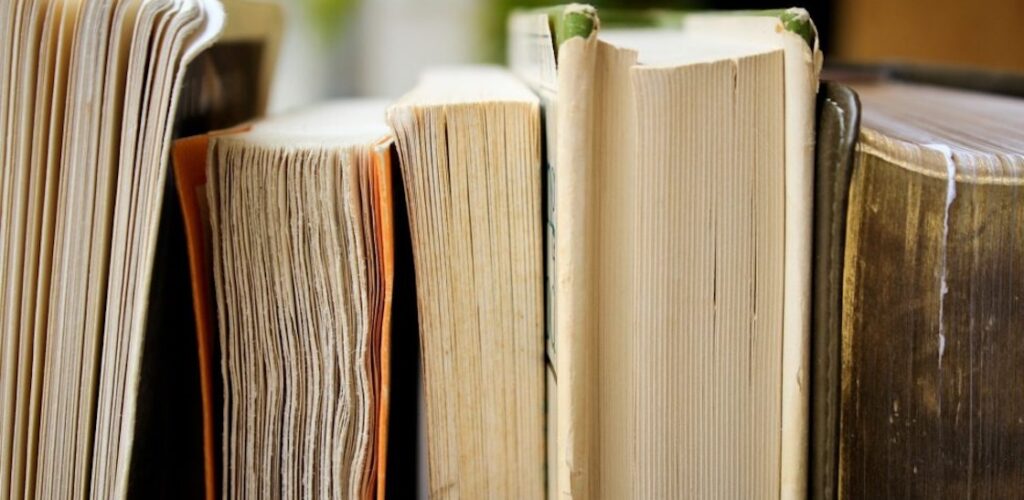Schon vor einigen Jahren hat das Team von SOCIUS Erfahrung mit gleich zwei trauernden Kolleg:innen gemacht, die innerhalb kürzester Zeit geliebte Menschen gehen...
Schon Anfang des Jahres 2017 habe ich dieses schriftliche Interview als Beitrag zur Masterarbeit von Christin Döhring zum Thema „Soziokratie – Potenziale und...
In unserer neuen Kategorie „SOCIA Ausblicke“ wollen wir versuchen regelmäßig unser Augenmerk auf die Situationen von Frauen* im Arbeitsleben in NGOs, im...
Zugegeben: wirklich gestorben war sie nicht, die Methode der Kollegialen Beratung, die sowohl Teams als auch so genannte stranger labs so bereichern kann. Dennoch:...
Manchmal will gut Ding Weile haben und es dauert bis wir es schaffen, Euch an unseren Gedanken und unserer Arbeit teilhaben zu lassen. Gerade sind uns zwei SOCIUS...
Jede Person, die Gruppen und Teams, egal welcher Größe begleitet, hat es schon mal erlebt: Es läuft nicht rund. Die Stimmung sinkt. Es gibt Widerstand. Es wird kein...