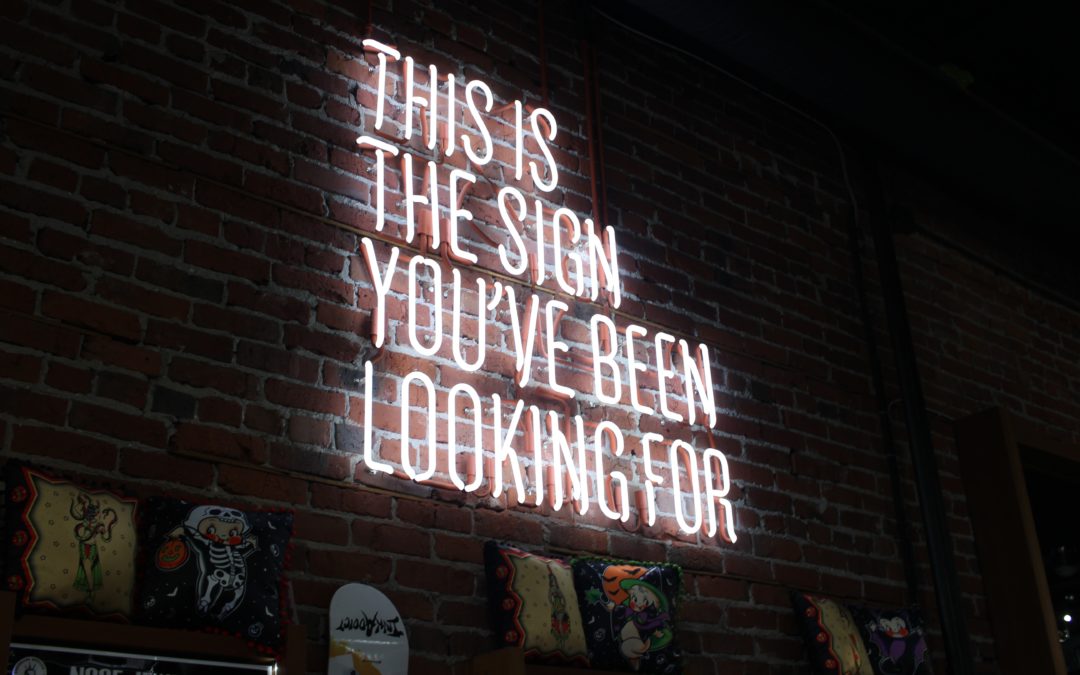- In welchem Rahmen sind Sie das erste Mal mit Soziokratie in Berührung gekommen?
Ich hab in brandeins 1/09 den Artikel „Die ideale Welt“ gelesen und wollte unbedingt mehr wissen. Ich bin dann auf das Soziokratische Zentrum Deutschland gestossen und habe im November 2009 ein Einführungsseminar Soziokratie bei Christian Rüther in München gemacht. 2012 habe ich dann das Intensivtraining „Creating workplaces where people can thrive“ bei Gregg Kendrick gemacht. Seitdem arbeite ich immer wieder gerne mit Christian Rüther zusammen und verbreite die Idee der Soziokratie wo es nur geht.
- Wie erklären Sie den geringen Bekanntheitsgrad der Soziokratie?
Meiner Beobachtung nach wird Soziokratie immer bekannter. Der eher langsame Prozess hat mE auch viel mit einer fehlenden Lobby zu tun. Die Aktivitäten der Soziokratischen Zentren DACH beugen sich offenbar nicht den Gesetzen eines Marketings des 21. Jahrhundert.
- Warum haben Sie sich für das Arbeiten in einer soziokratischen Organisation entschieden?
Mein Unternehmen würde ich nicht als soziokratisch nach allen Regeln der Kunst bezeichnen, und das wird es auch nicht werden, dazu ist es auch zu klein. Gleichzeitig teilen wir hier die soziokratischen Werte seit Gründung 1998: Selbstbestimmung, Transparenz, Beteiligung, gemeinsame Entscheidungen, Kontakt und Augenhöhe. [Edit 2021: Seit 2017 hat sich bei SOCIUS einiges getan: seit neuestem haben wir das Bekenntnis zur Konsent-Entscheidung in der Geschäftsordnung der SOCIUS eG verankert] [Edit 2023: und im Oktober 2022 haben wir bei der ersten deutschen Sociocracy for all Konferenz darüber gesprochen]
Soziokratie: Potenziale und Hindernisse
- Warum sollten aus Ihrer Sicht hierarchische Organisationkonzepte überholt werden?
Das sollten sie aus meiner Sicht gar nicht. Ich denke, dass es Organisationen oder Arbeitsbereiche gibt, in denen hierarchische Strukturen sehr sinnvoll sind. Z.B. bei der Feuerwehr im Einsatz. Oder im Flugzeug. D.h. nicht dass eine Gesamtstruktur immer hierarchisch sein muss , aber es gibt reichlich Situationen in denen ich froh bin über hierarchische Konzepte. Bei medizinischen Operationen z.B. auch.
- Welche Vorteile bietet die Soziokratie gegenüber einem hierarchisch geführten Unternehmen?
Soziokratie bietet dann Vorteile, wenn die oben genannten Werte geteilt werden. Und wenn Verantwortungsübernahme der einzelnen gewollt und gekonnt ist. Dazu brauchen Menschen oft Unterstützung. Unsere Gesellschaft ist nicht sehr darauf ausgelegt, dass Eigenverantwortung groß geschrieben wird. [Edit 2021: hierzu haben Bettina Rollow und Joana Breidenbach ein sehr gutes Buch geschrieben: New Work needs Inner Work]
- Wie löst man sich am besten von alten Paradigmen und gefestigten Strukturen um sich auf das Konzept einzulassen?
Ich denke es ist hilfreich, wenn man zunächst Verbündete findet im Unternehmen, die ähnliche Werte teilen und sich dort mit dem Konzept und der Kommunikation der Soziokratie im kleinen Kreis vertraut macht. Anschließend kann man anfangen mit den Ideen der Soziokratie in eben diesem Kreis „zu spielen“ und Einzelheiten davon weiter zu tragen, z.B. in Meetings. Wenn man jemanden aus der Führungsebene findet, der:die interessiert ist, gilt es diese Person einzubinden und nicht zu verprellen.
- Soziokratie basiert zu großen Teilen auf Vertrauen. Wie schafft man es, dieses bedingungslos auszuüben und „Macht und Kontrolle“ abzugeben?
Das ist oft eine große Herausforderung. Entweder hat es in der Führungsebene schon intrapersonelle Prozesse gegeben, in denen die Leitung persönlich an diesen Themen gearbeitet hat, oder aber es wird sie noch geben müssen. Soziokratie ist mE nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung zu etablieren.
- Soziokratie bedeutet auch, nicht gleich die perfekte Lösung zu finden – wie geht man damit um?
Die perfekte Lösung gibt es auch außerhalb der Soziokratie nicht, ich denke das die Suche nach einer machbaren Lösung, so wie es in der Soziokratie „propagiert“ wird realistischer ist. Die Loslösung vom Perfektionismus ist überfällig.
- Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in dem „iterativen“ Lösungsprozess? Ist dieser Prozess der klassischen Zielfestlegung überlegen? Wenn ja, warum?
Ich denke, dass iterative Prozesse einer „natürlichen“ Entwicklung sehr viel mehr entsprechen als klassische Zielsetzungen, die im Zweifel nicht erreicht werden, dafür aber Gefühle von Versagen hervorrufen, die nachweislich die Motivation und Kraft von Mitarbeitenden senken.
- Wie werden soziokratische Prinzipien bewahrt, wenn im Notfall schnell eine Entscheidung getroffen werden muss?
Schnelle Notfallentscheidungen können und sollen auch in soziokatischen Unternehmen top-down entschieden werden. Es geht darum Organisationen arbeitsfähig zu halten, zur möglichst großen Zufriedenheit.
- Funktioniert Soziokratie auch unabhängig von der Arbeitsumgebung und ließe sich ausschließlich mit modernen Kommunikationsmitteln, wie Online-Kommunikation umsetzen oder ist die persönliche Kommunikation ein essentieller Bestandteil?
Dazu kann ich leider nichts sagen. Ich vermute, dass Organisationen in denen die Menschen sich NIE sehen, es etwas schwieriger haben. Ich denke aber auch, dass Organisationen in denen Menschen sich NIE live und in Farbe sehen, es ohnehin etwas schwieriger haben.
- Gab es Situationen, in der die Soziokratie an ihre Grenzen gestoßen ist und Sie das Konzept in Frage gestellt haben?
In meiner Erfahrung sind eher Menschen an ihre Grenzen gestoßen als Konzepte.
Abschluss
- Worin sehen Sie die größten Hürden bei der Einführung von Soziokratie?
Im Willen und im Vertrauen. Auf Macht zu verzichten bedarf großer innerer Freiheit.
- In welchem Umfang besteht die Notwendigkeit des Erlernens von Methodenkompetenzen um soziokratisch arbeiten zu können?
Insbesondere die Art der Moderation der Kreise und des Konsents sollte mE von möglichst vielen Beteiligten geübt und gelernt werden. Dazu braucht es Bereitschaft, Gelegenheit und Unterstützung.
- Lässt sich Soziokratie in jedem Unternehmen problemlos umsetzten oder würden Sie einer bestimmten Branche, bzw. Unternehmensgröße davon abraten?
Ich glaube: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Wenn der Fokus auf „problemlos“ liegt, würde ich wohl mit Nein antworten, wenn der Fokus auf „umsetzen“ liegt, würde ich eher mit Ja antworten.
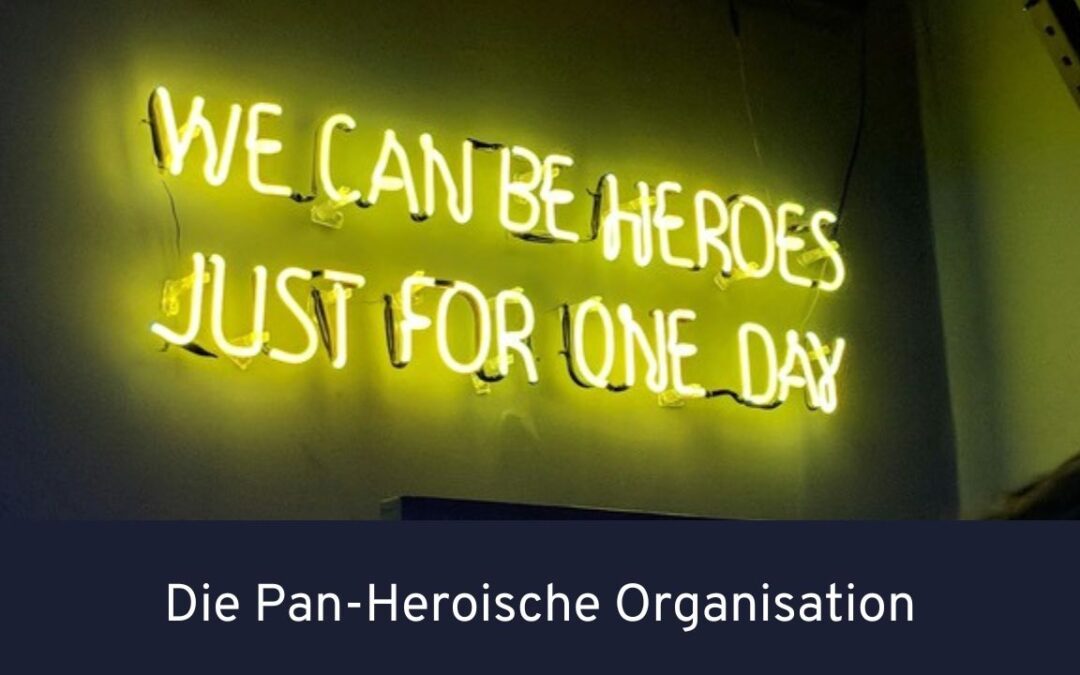





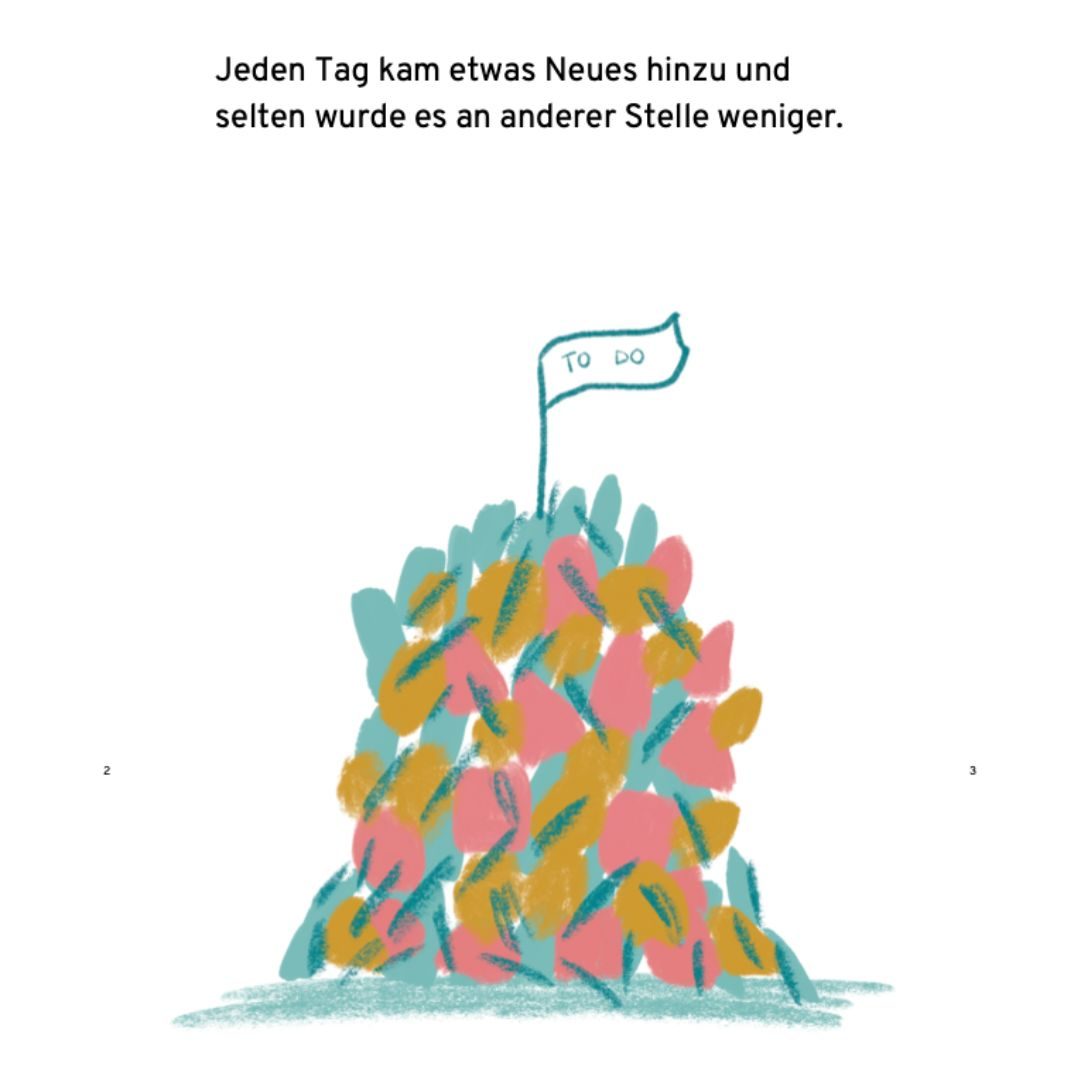

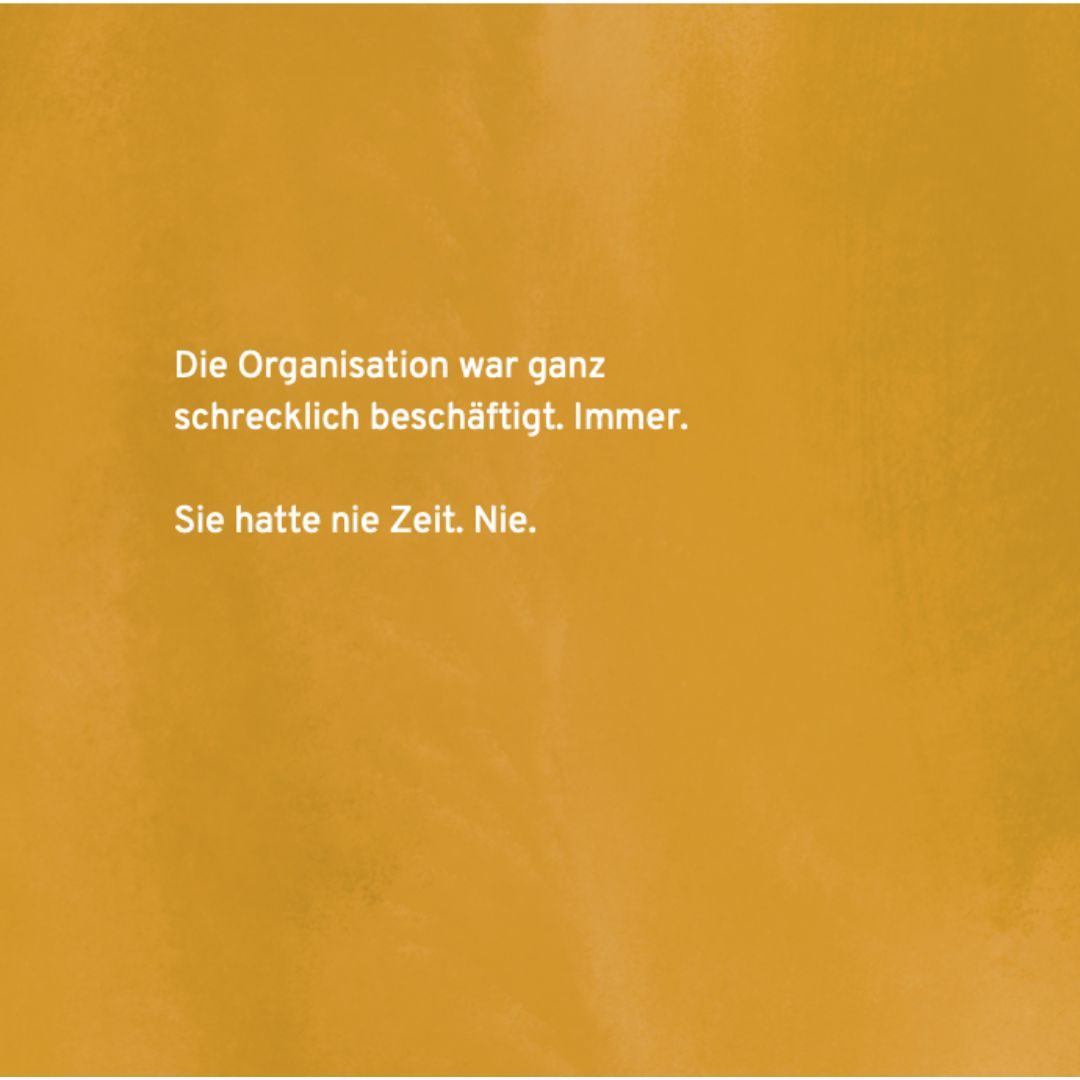
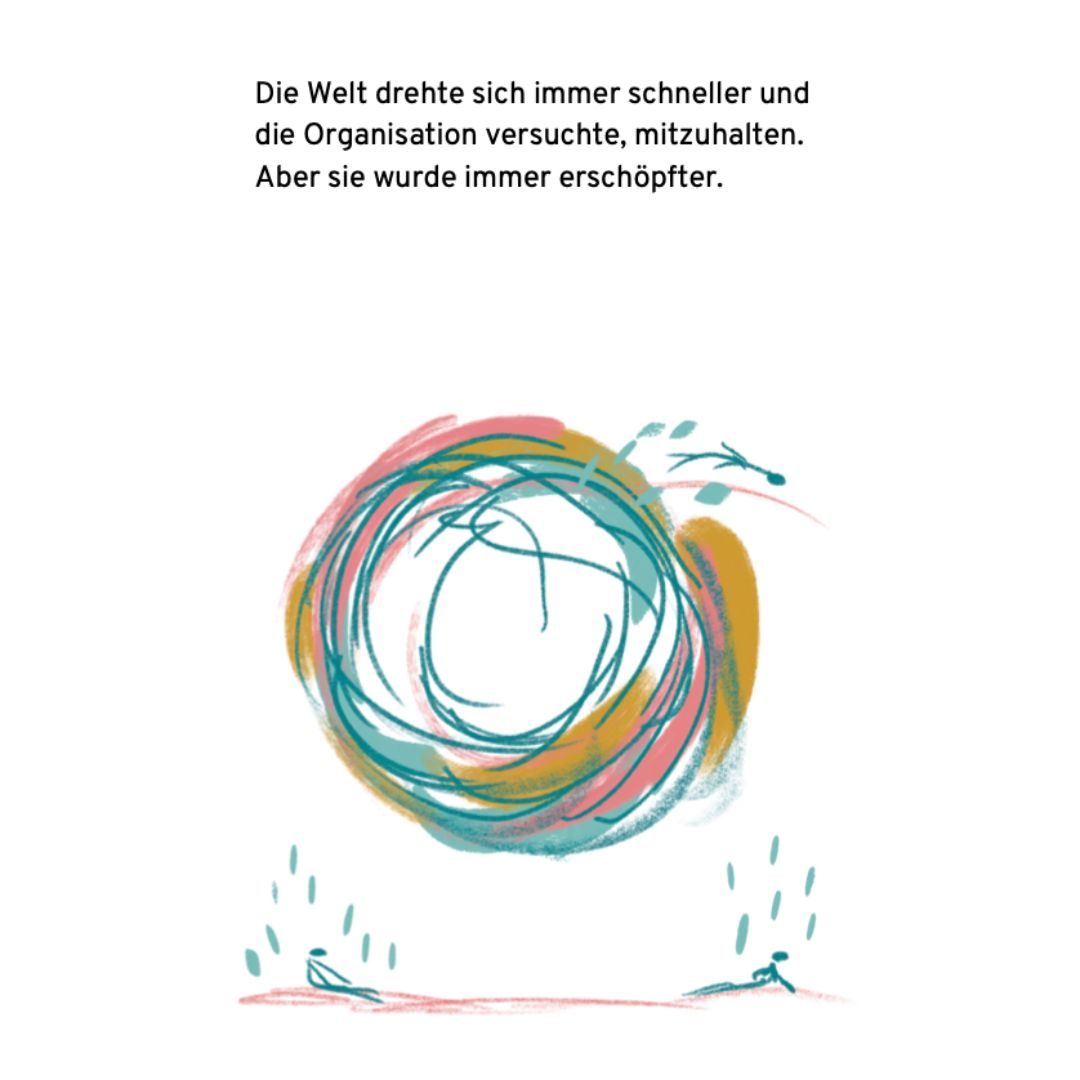
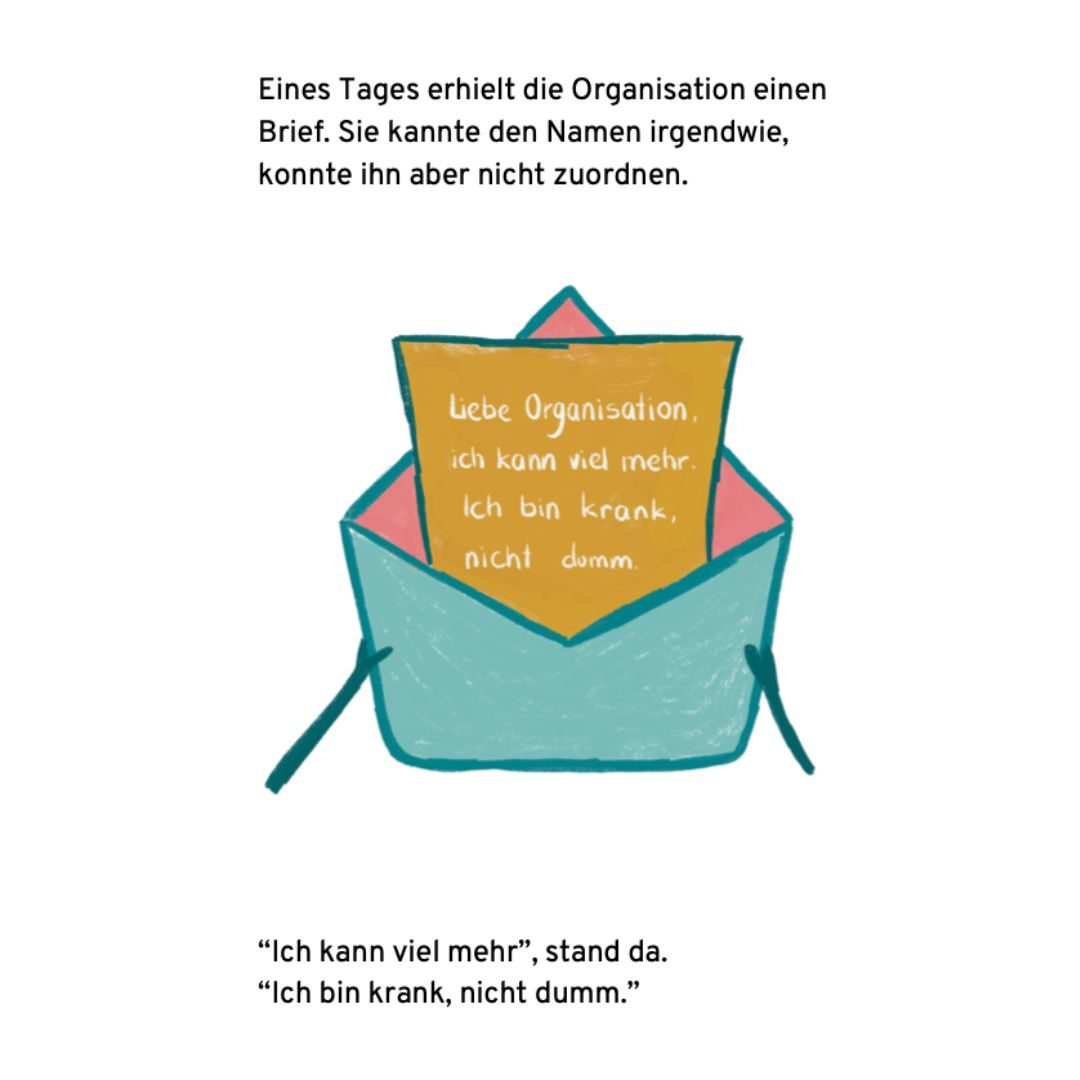

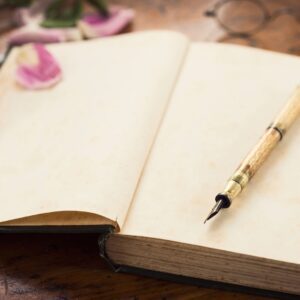 6 Journaling-Prompts zum ARLINA-Ritual “Innerer Kompass & mein Beitrag für die Welt”
6 Journaling-Prompts zum ARLINA-Ritual “Innerer Kompass & mein Beitrag für die Welt” 



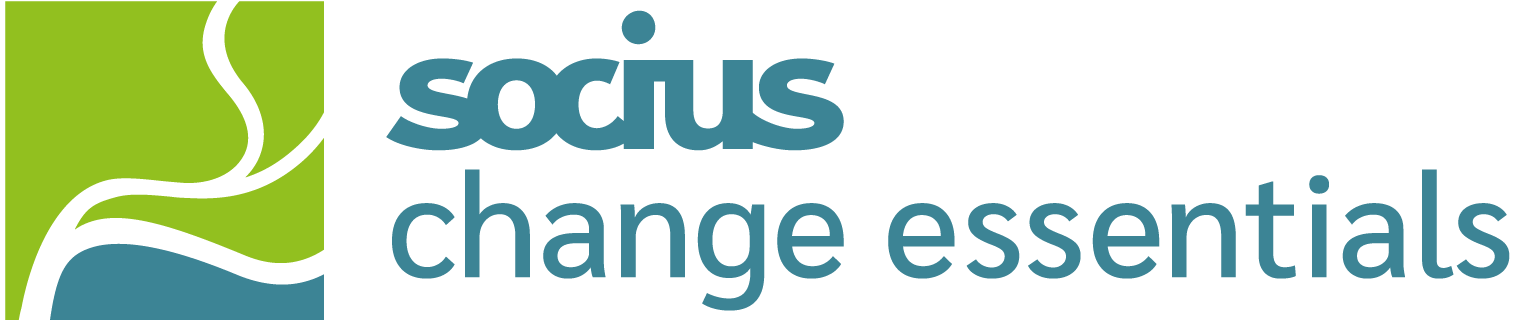


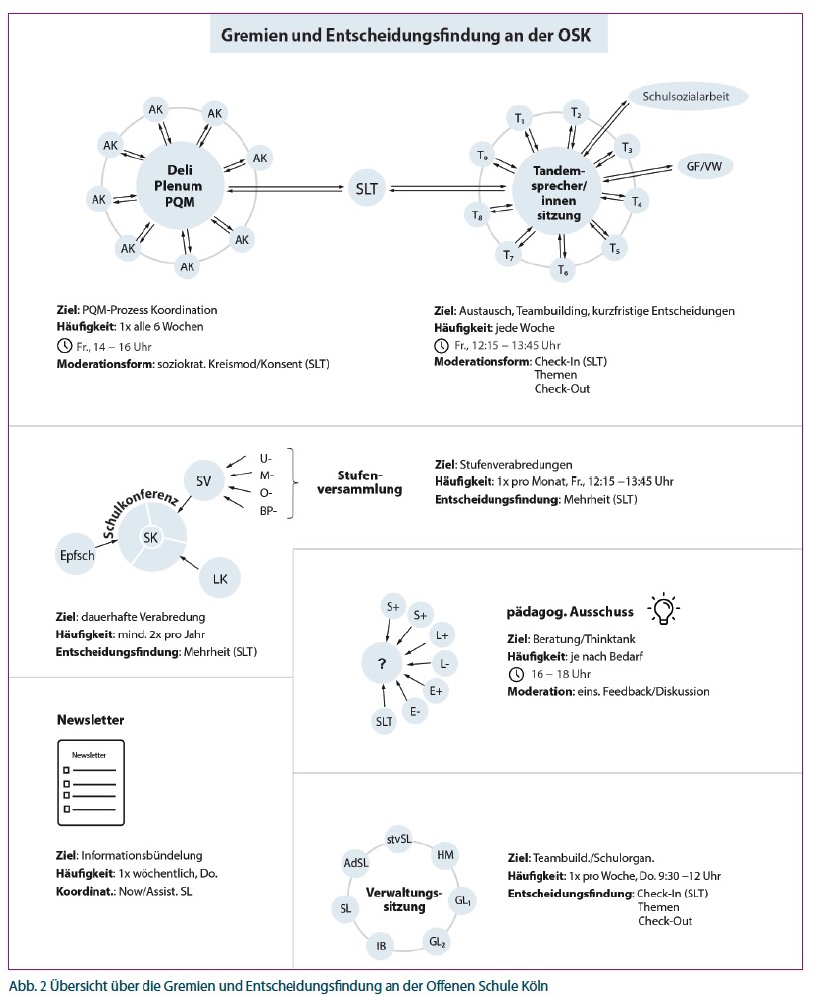
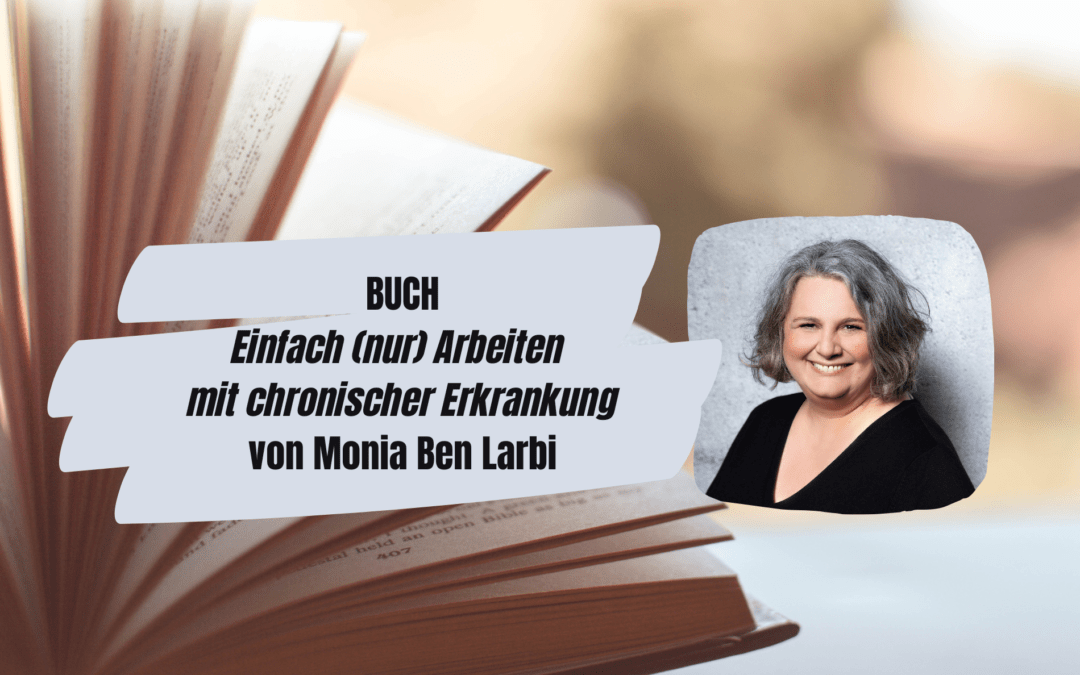

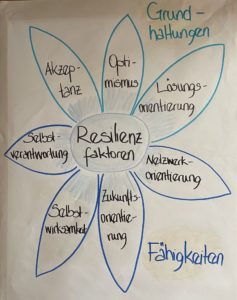 Den Rest des Tages widmeten wir uns in einem Wechsel von Pausen, Bewegung, Plenum und Kleingruppenarbeit zuvor vom Team identifizierten Stressoren mit der Brille
Den Rest des Tages widmeten wir uns in einem Wechsel von Pausen, Bewegung, Plenum und Kleingruppenarbeit zuvor vom Team identifizierten Stressoren mit der Brille 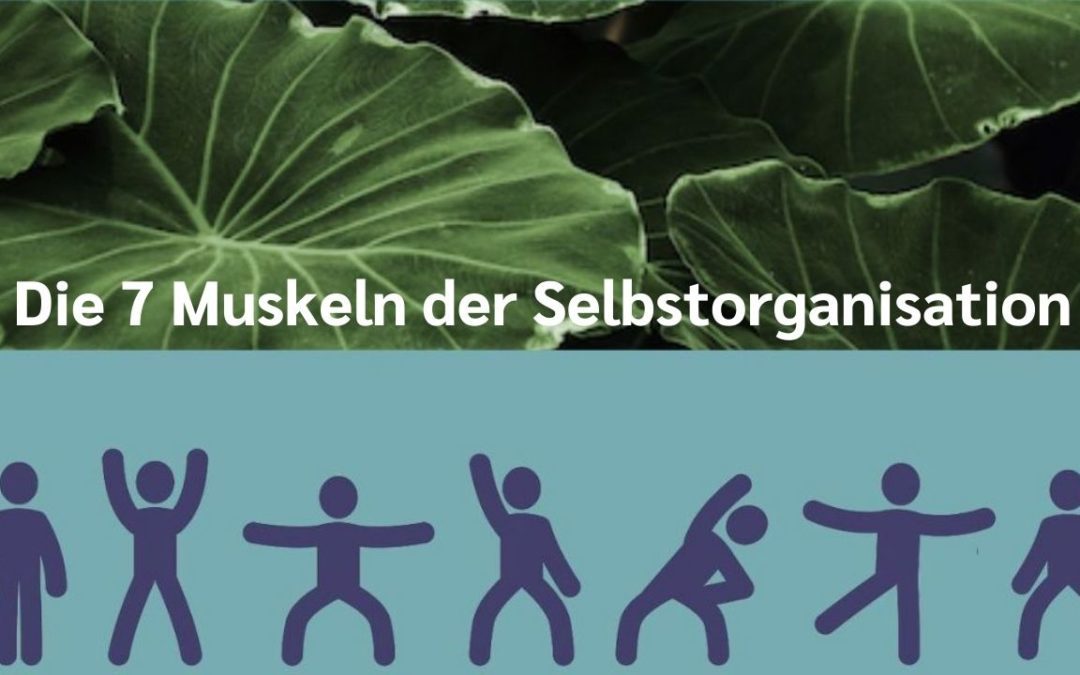

 Einer der hartnäckigsten Vorbehalte gegenüber Praktiken der Selbstorganisation ist, dass sie zu zeitaufwändig sind. „In ruhigen Gewässern können wir uns den Luxus dezentralisierter Kontrolle leisten, aber wenn das Wetter rau wird und viel auf dem Spiel steht, sollten wir besser auf etwas Strafferes und Effizienteres zurückgreifen“. Sehen wir da mal etwas genauer hin: Selbstorganisation wird vor allem da langsam, wo Vertrauen fehlt. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Teammitglieder inkompetent sind oder ihre Macht missbrauchen und in einer Weise handeln, die eher ihren eigenen Interessen als unserer gemeinsamen Sache dient, werde ich versuchen, sie zu kontrollieren. Ich sorge dafür, dass Reports und Entscheidungen im Plenum erfolgen und dass Genehmigungsschleifen und dreifache Kontrollsysteme installiert sind. All das macht Prozesse langsam und uninspirierend. Wenn ich dagegen darauf vertraue, dass meine Mitstreiter:innen die gemeinsame Sache im Blick haben und kompetent (oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen) handeln, kann ich mich auf ein handhabbares Minimum an Kontrolle einlassen und so ein Maximum an Dynamik ermöglichen. Die Zone dessen, was „sicher genug ist, um es zu versuchen“, wächst.
Einer der hartnäckigsten Vorbehalte gegenüber Praktiken der Selbstorganisation ist, dass sie zu zeitaufwändig sind. „In ruhigen Gewässern können wir uns den Luxus dezentralisierter Kontrolle leisten, aber wenn das Wetter rau wird und viel auf dem Spiel steht, sollten wir besser auf etwas Strafferes und Effizienteres zurückgreifen“. Sehen wir da mal etwas genauer hin: Selbstorganisation wird vor allem da langsam, wo Vertrauen fehlt. Wenn ich davon ausgehe, dass meine Teammitglieder inkompetent sind oder ihre Macht missbrauchen und in einer Weise handeln, die eher ihren eigenen Interessen als unserer gemeinsamen Sache dient, werde ich versuchen, sie zu kontrollieren. Ich sorge dafür, dass Reports und Entscheidungen im Plenum erfolgen und dass Genehmigungsschleifen und dreifache Kontrollsysteme installiert sind. All das macht Prozesse langsam und uninspirierend. Wenn ich dagegen darauf vertraue, dass meine Mitstreiter:innen die gemeinsame Sache im Blick haben und kompetent (oder zumindest nach bestem Wissen und Gewissen) handeln, kann ich mich auf ein handhabbares Minimum an Kontrolle einlassen und so ein Maximum an Dynamik ermöglichen. Die Zone dessen, was „sicher genug ist, um es zu versuchen“, wächst. Führen ist ein Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen. Die Bewusstheit fürs Innere, das Spüren und Vertrauen in unsere Intuition, steht dabei der Wahrnehmung und Deutung des sozialen Feldes gegenüber. Wenn wir den Kontakt zu einer der beiden Seiten verlieren, wenn die beiden Welten sich vermischen oder eine das Handeln dominiert, wird Führung schwierig. In selbstorganisierten Teams ist Führungsenergie zwar verteilter und dynamischer als in klassischen hierarchischen Organisationen, aber der Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen ist genauso delikat. Führungshandeln erfordert einen souveränen Umgang mit diesen Impulsen und die Fähigkeit, darin sinnvoll und unerschrocken zu handeln.
Führen ist ein Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen. Die Bewusstheit fürs Innere, das Spüren und Vertrauen in unsere Intuition, steht dabei der Wahrnehmung und Deutung des sozialen Feldes gegenüber. Wenn wir den Kontakt zu einer der beiden Seiten verlieren, wenn die beiden Welten sich vermischen oder eine das Handeln dominiert, wird Führung schwierig. In selbstorganisierten Teams ist Führungsenergie zwar verteilter und dynamischer als in klassischen hierarchischen Organisationen, aber der Balanceakt zwischen inneren und äußeren Impulsen ist genauso delikat. Führungshandeln erfordert einen souveränen Umgang mit diesen Impulsen und die Fähigkeit, darin sinnvoll und unerschrocken zu handeln.  Der Weg zur Selbstorganisation erfordert eine schrittweise Verlagerung von äußeren Strukturen hin zu innerer Kompetenz und persönlicher Entwicklung als Quellen von Stabilität
Der Weg zur Selbstorganisation erfordert eine schrittweise Verlagerung von äußeren Strukturen hin zu innerer Kompetenz und persönlicher Entwicklung als Quellen von Stabilität Die Bedeutung von Resonanz für jegliche soziale Praxis liegt auf der Hand. Für die Praxis der Selbstorganisation ist sie besonders relevant: Die adaptive Qualität von selbstorganisierenden Systemen zielt auf die laufende Anpassung an ihrer Umwelt. Zur Umwelt gehört dabei das externe Feld, aber auch die interne Dynamik, die die Mitglieder einbringen. Die wirklich spannenden Dinge in diesen beiden Bezugswelten liegen unsichtbar unterhalb der Wasserlinie. Auf kollektiver Ebene bedeutet Resonanz, solch verborgene Dynamiken zu erspüren.
Die Bedeutung von Resonanz für jegliche soziale Praxis liegt auf der Hand. Für die Praxis der Selbstorganisation ist sie besonders relevant: Die adaptive Qualität von selbstorganisierenden Systemen zielt auf die laufende Anpassung an ihrer Umwelt. Zur Umwelt gehört dabei das externe Feld, aber auch die interne Dynamik, die die Mitglieder einbringen. Die wirklich spannenden Dinge in diesen beiden Bezugswelten liegen unsichtbar unterhalb der Wasserlinie. Auf kollektiver Ebene bedeutet Resonanz, solch verborgene Dynamiken zu erspüren.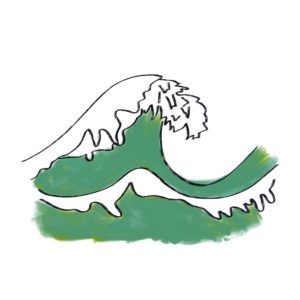 Souveränität in rauhen Gewässern
Souveränität in rauhen Gewässern Komplexitätsbewusstsein (
Komplexitätsbewusstsein (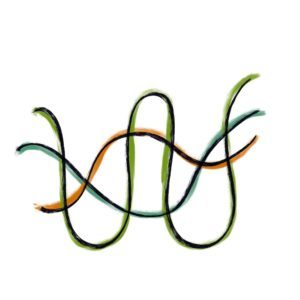 Der letzte Muskel ist der kniffligste und umfassendste. „Groove“ ist ein nebulöses Konzept das schwer zu operationalisieren ist (können Algorithmen miteinander grooven?). Die erste Zutat zum Groove ist „Alignment“ – eine Qualität, die sich vielleicht am besten mit „gemeinsamer Ausrichtung“ übersetzen lässt; die zweite ist lebendige Dynamik, oder auch „Swing“.
Der letzte Muskel ist der kniffligste und umfassendste. „Groove“ ist ein nebulöses Konzept das schwer zu operationalisieren ist (können Algorithmen miteinander grooven?). Die erste Zutat zum Groove ist „Alignment“ – eine Qualität, die sich vielleicht am besten mit „gemeinsamer Ausrichtung“ übersetzen lässt; die zweite ist lebendige Dynamik, oder auch „Swing“.