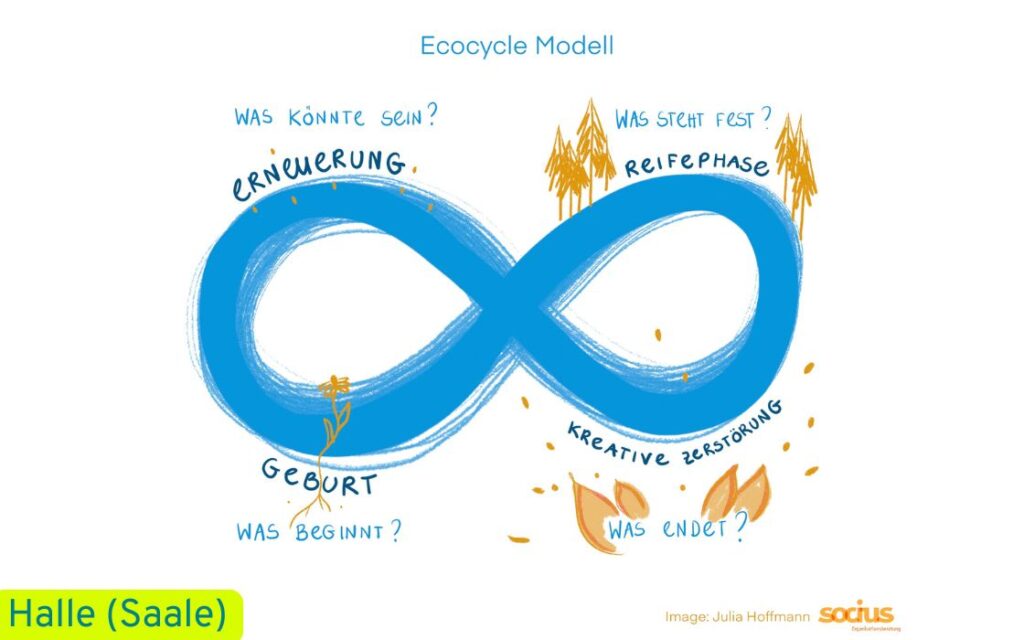- Beratung und Prozessbegleitung:
Wir helfen euch, Strukturen und Entscheidungsprozesse zu entwickeln, die eure Selbstorganisation stärken – mit einem besonderen Fokus auf die Prinzipien der Soziokratie und agile Arbeitsformen. - Weiterbildungen wie Selbst:Organisations:Entwicklung (3 moduliger Zyklus zur Schnittfläche von Selbstorganisation und OE) und Soziokratie Zieht Kreise (Online Grundlagenkurs)
- Individuelle Kompetenzentwicklung:
Wir bieten flexible Lern- und Austauschformate, wie das Trainingsprogramm „Die 7 Muskeln der Selbstorganisation“ oder das Kollegiale Format „Leadership in Selbstorganisation (LiSO)“. - Förderprogramme:
Als zertifizierte Partner:innen des INQA-Coaching-Programms unterstützen wir euch bei der Einführung und Stärkung selbstorganisierter und agiler Arbeitsformen – möglicherweise mit Fördermitteln des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.

Blogbeiträge zum Thema: Selbstorganisation
Die Kultivierung von Vertrauen gehört zur den Grundaufgaben sozialer Entwicklung. Ob als Selbstvertrauen, als Vertrauen in relevante Andere, als Strukturvertrauen...
Die SOCIUS Organisationsberatung gGmbH – die 1998 gegründet wurde und mittlerweile die Tochter der SOCUS eG ist – wurde in den vergangenen 15 Jahren durch Christian...
Der Weg von hierarchischer zu gemeinsamer & geteilter Führung verläuft durch zerklüftetes Terrain. Wo Gründer:innen und langjährige Führungspersönlichkeiten die...
Veranstaltungen zum Thema: Selbstorganisation
SOCIUS labor Halle: Dienstag, 14. April 2026, 15 bis 19 Uhr
Infoabend am 25. Februar 2026, 16 bis 17 Uhr
Das Fitnessprogramm für selbstorganisierte Teams (Termine auf Anfrage)
SOCIUS labor Berlin: Freitag, 27. Februar 2026, 15 bis 19 Uhr
Fortbildung in Stolzenhagen von April bis August 2026