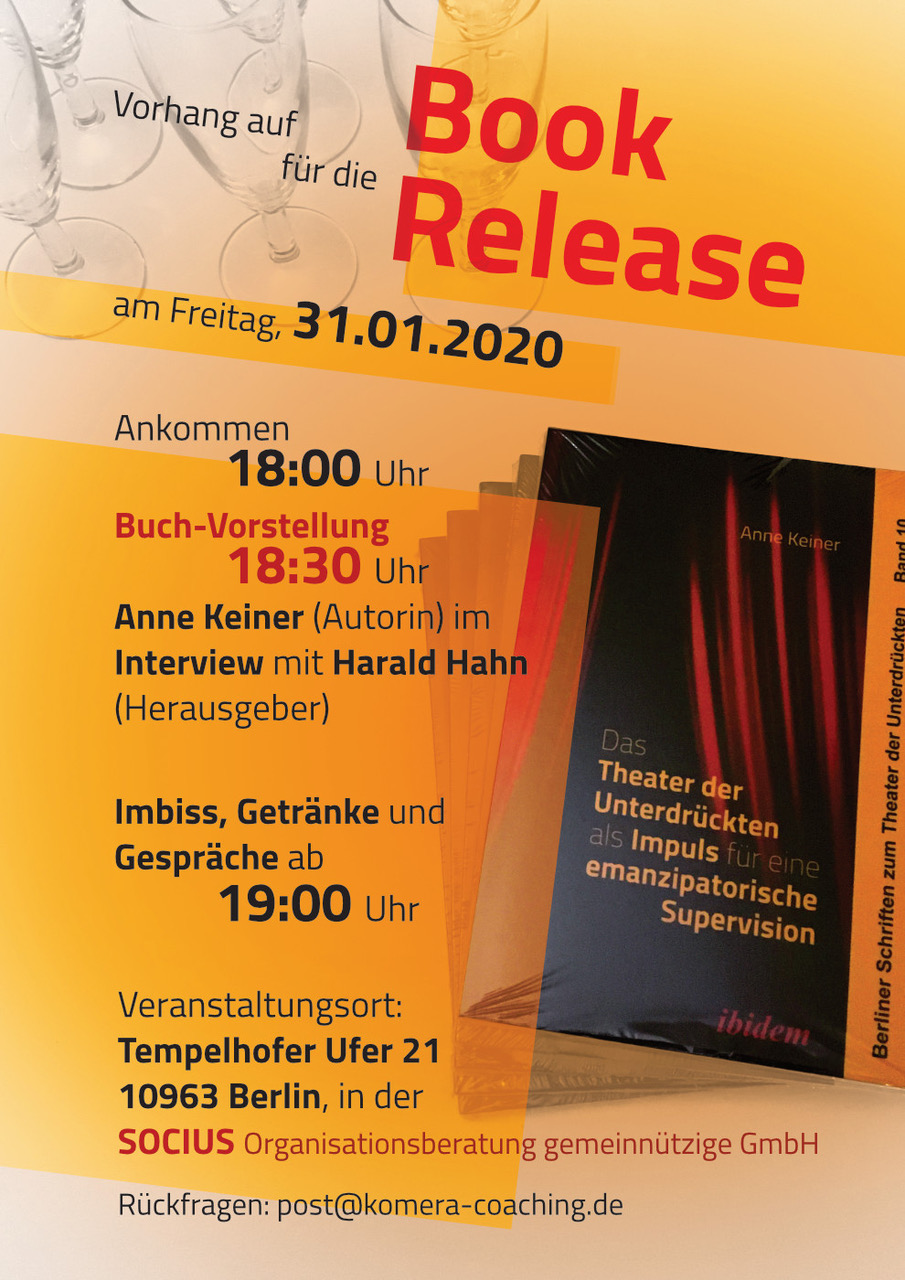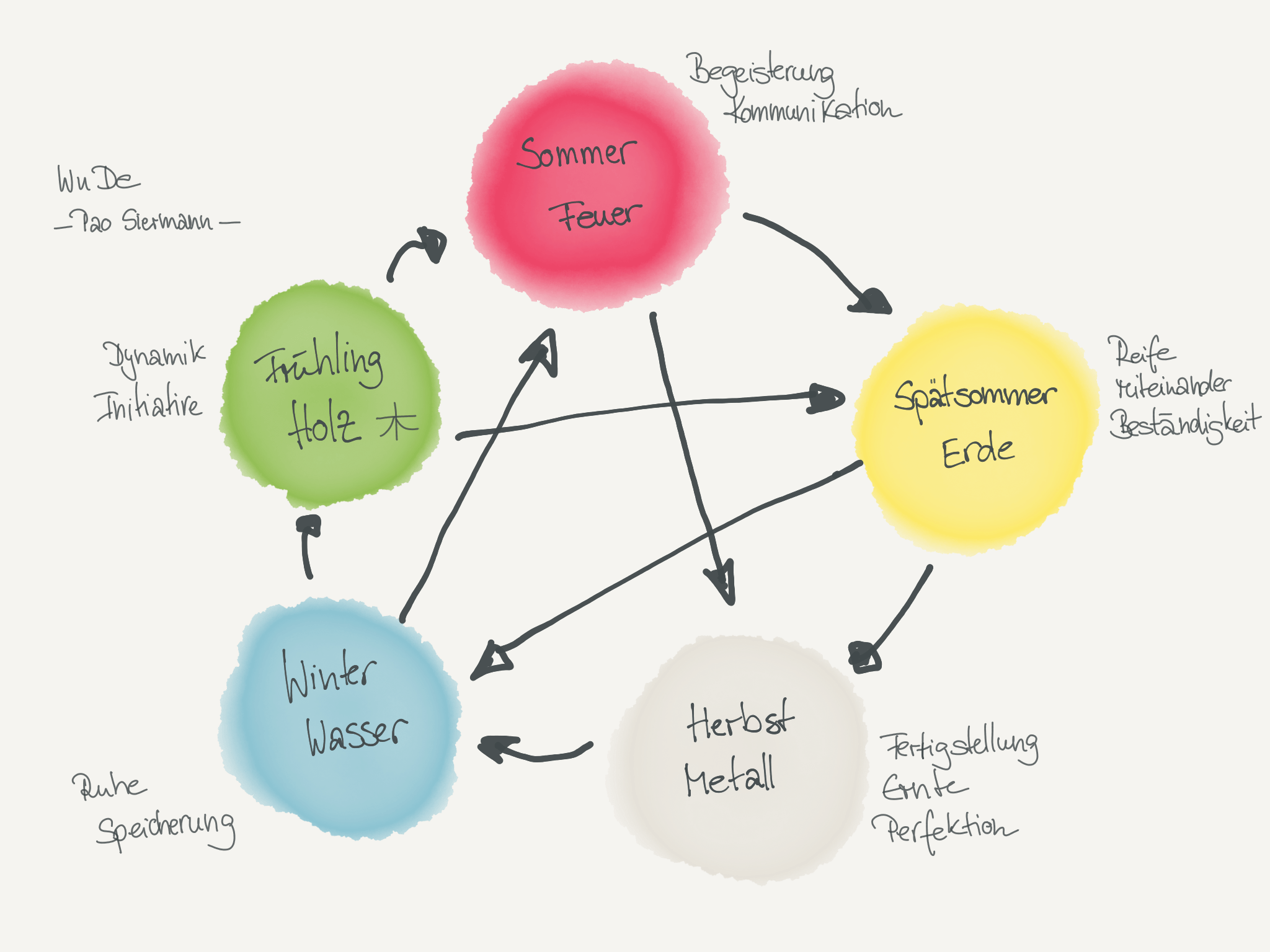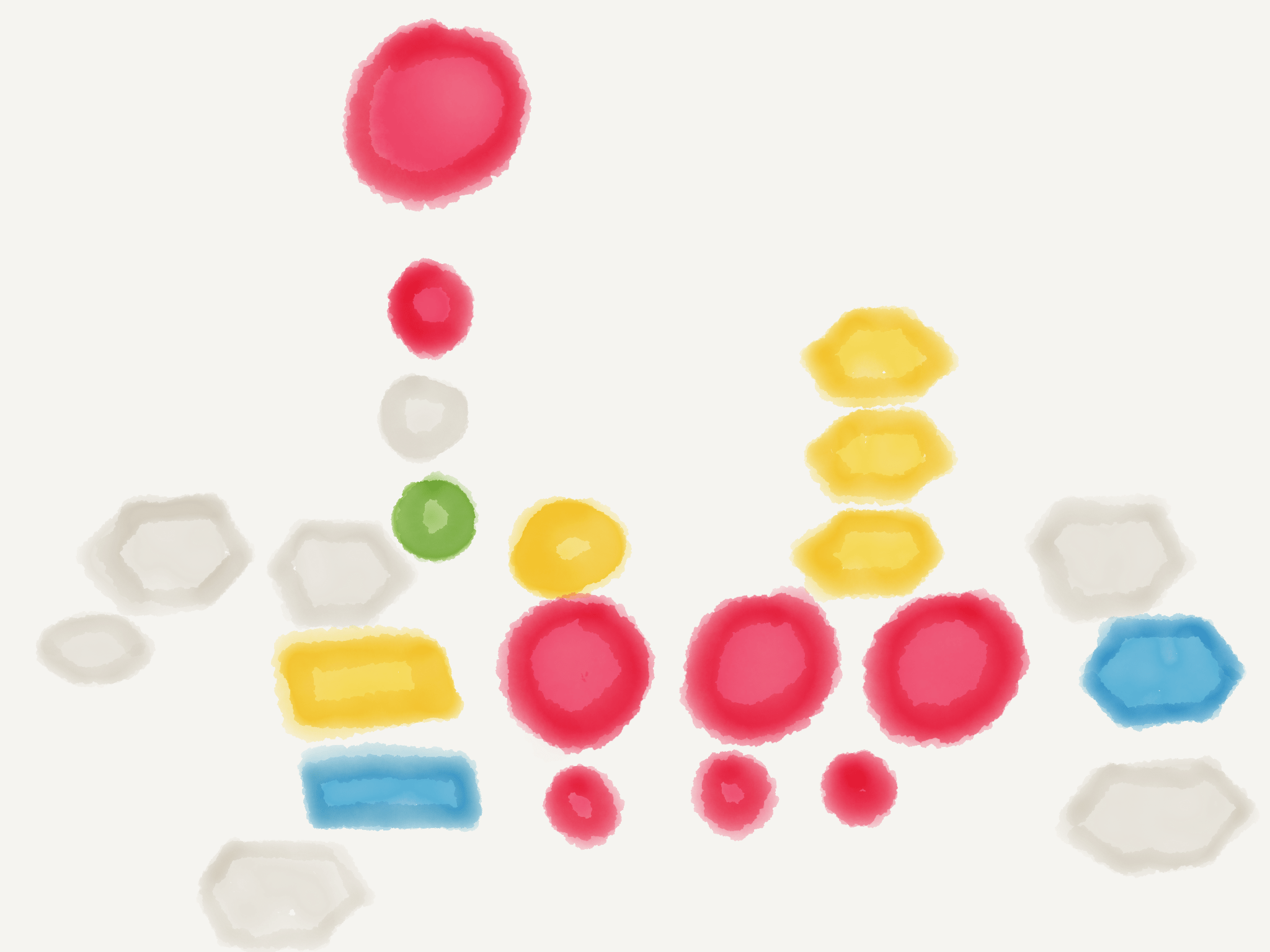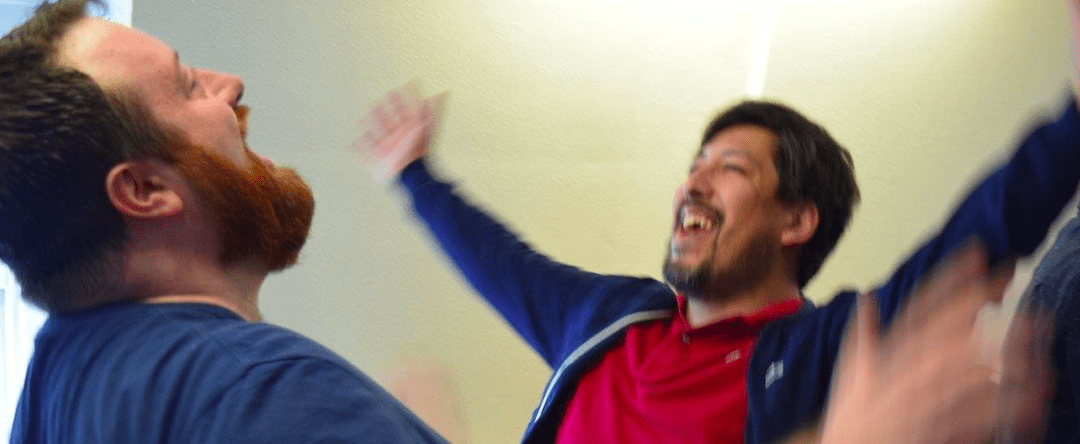SOCIUS labor Bericht: Gemeinsam wissen – The Art of Harvesting
In sicheren Räumen mit zugewandten Menschen zu experimentieren, ist ein Luxus, den wir uns regelmäßig in den Laboren gönnen. So war auch beim Labor im Dezember die Ziele und Hintergründe vielfältig: Julia Hoffmann und ich wollten zusammen Arbeitserfahrung sammeln und teilen – speziell im Hinblick auf den Arbeitsansatz des „Art of Hosting and Harvesting“, in dem Julia bereits intensiv Erfahrungen gesammelt hat, ich mich als „bescheidenen Anfänger“ bezeichnen würde.
Wie kam es zum Labor?
Wie wahrscheinlich viele empfanden wir das Jahr 2020 als Herausforderung. Unsere Lebens- und Arbeitszusammenhänge haben sich massiv verändert und für viele zu weitreichenden Fragen ihrer Lebensgestaltung, ihrer Tagesabläufe, ihrer Gestaltung der persönlichen und Arbeitsprozesse geführt. Nicht wenige waren mit existenziellen Momenten konfrontiert, deren Tragweite von außen nur schwer nachvollzogen werden kann. Ebenso gab es – vielleicht ungleich verteilt – Momente gemeinsamen Lernens (online und offline), die Entwicklung neuer beruflicher Kompetenzen und reges Experimentieren im beruflichen und privaten Zusammenkommen unter besonderen Situationen.
Gerade angesichts der Unsicherheiten wie selten zuvor, sollten Möglichkeiten der gemeinsamen Reflexion, des Austausches und des Lernens stattfinden. Interessant war hier, wie oft während des Check-Ins bei unserem Labor geäußert wurde, wie selten dieser Rückblick stattfand und wie notwendig ihn auch viele Teilnehmer*innen waren. Die Gründe dafür sind spekulativ: wenig Zeit – auch dieses Jahr stand ein Weihnachten zu organisieren (wenn auch anders) vor der Tür; auch 2020 war das Jahresende besonders „aktiv“ und mussten Projekte abgeschlossen werden; aber vielleicht auch, weil wir uns auch hier noch in neuen Formen einüben müssen?
Der Arbeitsansatz der „Art of Hosting and Harvesting“ bietet viele kreative Möglichkeiten des Rückblicks, des Austausches und der Reflexion – einander zugewandt und in geteilter Verantwortung. Moderator*innen werden als Gastgeber*innen genannt („Hosts“ oder „Stewards“); es ist nicht nur ein semantisches Ornament, sondern ein Schlaglicht auf das Selbstverständnis von „Art of Hosting“. Gesucht wird das Unbekannte, das entsteht, wenn Menschen in gemeinsamen Austausch darüber treten. Gastgeber*innen sind Beteiligte in dem Kreis und Mitsuchende im Austausch. Es geht um Raum schaffen, gemeinsames Explorieren und tiefes Zuhören und Nachvollziehen und gemeinsames Verstehen als ein gemeinsam verantwortetes „Projekt“.
Was – glauben wir – war anders als üblich?
Bewusst begannen wir mit einem dreiteiligen Check-In – ungewollt hatten wir da bereits unsere Zeitplanung überschritten. Unsere drei Schritte des Einstiegs:
- Körperliches Ankommen – kurzes eigenes Massieren des Gesichtes (wahlweise bei aus- oder angeschalteter Kamera) und bewusstes mehrfaches Ein- und Ausatmen.
- Persönliche Vorstellung („Wer bin ich?“, „Was bringt mich hier her?“).
- Gedicht: „Winternacht“ von Eichendorff mit Resonanzen
Die „Entschleunigung“ verlief deutlich intensiver als gedacht. Die persönliche Vorstellung hatte eine Tiefe, die wir zumindest so nicht erwartet hatten. Deutlich wurden hier schon die teilweise existenziellen Herausforderungen, vor denen wir im letzten Jahr standen. Deutlich wurde hier auch der Wunsch nach tiefen Gesprächen über das, was war; das Nutzen des Jahreswechsels, um in ein eigenes Narrativ des Jahres zu kommen, ein eigenes Verstehen dessen was passiert ist.
Damit waren aber auch unsere Zeitpolster unerwartet aufgebraucht. Wir standen in dem Dilemma, den Austausch zu ermöglichen und zu unterstützen – das war ja auch unser Ziel des Labors – und dem geplanten Verlauf voranzutreiben und diesen Raum eigentlich in den später gedachten Triaden zu erhalten. Ein Thema, bei dem ich merke, wieviel schwieriger „Zeitmanagement“ online einzuhalten ist als offline. Insbesondere wenn der Container genutzt wird, ist seine Reduktion später deutlich schwieriger als in Treffen vor Ort.
Gleichzeitig konnten wir entspannt bleiben, denn wir hatten die vier Stunden (ein Labor geht in der Regel von 16-20 Uhr) nicht ausgeplant. So konnten wir mit überschaubarem Aufwand nachsteuern, gleichzeitig war das eine hilfreiche Lernerfahrung für uns beide.
Die anschließenden Triaden waren für uns das „Herzstück“ des Abends. In Kleingruppen à 3 Personen luden wir die Teilnehmer*innen ein, von ihrem Jahr 2020 zu erzählen. Fragestellung war: „Was hatte für mich im ausgehenden Jahr 2020 Bedeutung und was davon will ich „in die künft’ge Frühlingszeit?“ mitnehmen?“. Triaden sind Gesprächsformate in klar verabredeten Rollen. Durch die Fokussierung auf eine*n Erzähler*in können substantiellere Reflexionsebenen erreicht werden, als in einem „freien Gespräch“. Die Rollen im Einzelnen:
- Ein*e Erzählerin erzählt und berichtet von eigenen Resonanzen zur Fragestellung. Ihre Assoziationen, Erkenntnisse und Eindrücke sind die richten – es gibt keine „falsche Erzählung“.
- Ein*e Gesprächspartner*in unterstützt die Erzählung durch zugewandte Rückfragen und empathische Reaktionen. Sie bleibt dabei in der Geschichte des*r Erzähler*in, und kommt nicht in die eigene. Manchmal ist es hilfreich, dass die Gesprächspartner*in die Erzählung sehr aktiv durch unterstützt, manchmal eher in ruhiger Präsenz.
- Eine*r oder mehrere (wenn es in 3er Runden nicht aufgeht) Zeug*innen hören empathisch dem Nachhall des Gespräches. Diesen Nachhall können sie im Anschluss als die „verborgenen Schätze“ mit dem*der Erzähler*in teilen. Möglichkeiten sind eigene lebendige emotionale Reaktionen auf das Erzählte, Gesten oder andere Eindrücke während der Erzählung, oder Worte, die besonders auf lebendige Aufmerksamkeit gefallen sind. Ihre Resonanz sind für den*die Erzähler*in häufig eine weitere Perspektive und ergänzender Blickwinkel der eigenen Erzählung.
Ein gut vorher definierter Zeitplan unterstützt dieses Setting. In abschließenden fünf Minuten konnten die Kleingruppen ihre Erfahrungen reflektieren.
Rückmeldungen waren vielfältig. Die Zeug*innenschaft wurde als hilfreich und unterstützend erwähnt, ebenso die Möglichkeit, vertieft in eine Geschichte einzudringen und auch das damit manchmal verbundene Schweigen gemeinsam zu erfahren – und nicht eine Vielzahl an Geschichten aufzumachen, die nebeneinander stehen.
In einer Plenumsrunde haben wir nach diesen Erfahrungen nach einer Aussicht für 2020 gefragt: „Wie können wir das nächste Jahr- einzeln oder in Gruppen – mit Zuversicht gestalten?“ Hier sind wir im Plenum zusammen geblieben und haben in sehr ruhigem Tempo zu Assoziationen und Resonanz eingeladen.
Die Fragestellung wurde als sperrig wahrgenommen, vielleicht war sie auch in der ganzen Entschleunigung zu „aktivistisch“. Es ginge eher um „Hoffnung“ statt „Zuversicht“ und das „gestalten“ wäre noch gar nicht dran – so lauteten einige Reaktionen. In Abgrenzung und Zustimmung auf diese Frage kamen aber viele Reaktionen – das Gedicht ist eine Zusammenfassung
Sonnenaufgang in hässlicher Gartenlandschaft
2020 ein wesentliches Jahr und hinterher ist nichts mehr wie vorher.
es hat für alle gereicht um ordentlich erschöpft zu sein
Ich muss Halt bei mir suchen und von dort aus losgehen
Wo ist mein Urvertrauen
sei mal ganz still und hör dir mal zu: Zuversicht ist nicht so groß wie Hoffnung
Da ist ein Grummeln;
Ist die Frage nicht eher, wie kann ich jeden Tag die Zuversicht nähren?
Zuversicht ist die Dinge ein Stück weit laufen zu lassen und mich drauf ein zu lassen
Wie kann ich mich und andere mit Zuversicht ausstatten?
Die Zuversicht durch das Wir – wir können das zusammen machen
die passive Form der Zuversicht: den Rahmen halten auch wenn man grad nicht so da ist
drei Supervisionen vor Weihnachten weiß ich: Zum Gestalten hört auch Lücken lassen
ein atmender Prozess
ein
und
aus
Vielleicht will gar nicht richtig gestalten – drauf vertrauen, dass ich nicht untergehen werde
Ein Jahr lässt sich nicht gestalten – Momente lassen sich gestalten: Welche Entscheidungen treffen wir?
Sie werden doch nicht als erstes die Sozialleistungen kürzen – doch. Sie wollen
Und wir werden ihnen beibringen, dass sie das nicht tun.
Als Netzwerk etwas ganz besonderes tun und uns das zurück kämpfen.
Wir können versuchen unsere Gegenüber als Sonnenaufgang betrachten
und uns überraschen lassen von Menschen und Situationen
Ich möchte mit dem Gestalten in eine neue Beziehung treten
ausatmen dürfen, loslassen können
Loslassen
leichter werden: es nimmt sich gerade Raum in mir
Wie kann ich, können wir in unsere Momente die Zuversicht einladen? und nicht aus Angst handeln, und Entscheidungen aus Zuversicht treffen damit wir wirklich gestalten und füreinander sorgen?
Was haben wir gelernt?
Leider war zum Ende nicht mehr viel Zeit für methodische Auswertung. Ein paar Stichworte dessen, was ich gelernt habe und welche Erfahrung sich bestätigt hat als pragmatisches Ende.
- Die „richtige“ Frage gibt es einerseits nicht, sie herauszufinden ist aber doch Teil des Erfolges. Ebensowenig gibt es selten eine komplett falsche Frage, aber es gibt immer das Risiko, die Dynamik deutlich zu verändern.
- Wenn ein Team / eine Teilnehmer*innengruppe erstmal entschleunigt ist, folgt sie auch hier dem Gesetz der Trägheit: gesteigertes Tempo braucht gesteigerte Energie.
- „You never host alone“ – „Du kannst nicht einzelner Gastgeber sein“, lautet eine Grundregel im Art of Hosting. Das hat sich für mich erschlossen, nicht nur wegen der besonderen online-Situation. Bei der gewünschten Tiefe offener Gespräche und zuhören auf die leisen Zwischentöne, ist es hilfreich zu zweit zu sein. Das gilt auch und insbesondere schon für die Vorbereitung.
„Art of Hosting“ hat viele Praktiken integriert. So sind die Triaden vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen bekannt. Mich reizt hier das konsequente Eindampfen zu Essenzen. Vielleicht haben wir im Experiment übertrieben, aber aufeinander folgende Check-Ins, Kleingruppen, mit deren Essenz in anderen Kleingruppen oder im Plenum weiter gearbeitet wird. Ein Gedicht als Harvesting, das die anderen Sinne anspricht. Der deutliche Fokus auf kollaborative Verantwortung. Das sind die Elemente, die Anregung bringen und weitere Möglichkeiten aufzeigen.
Sally Denham-Vaughan hat 2005 eine Dialektik von „Will“ – der gezielten und geplanten Aktion und Sitzung – und „Grace“ – dem gemeinsam emergent und dialogisch entstehenden – herausgearbeitet. Während das Zielgerichtete angestrebt werden kann, ist „Grace“ etwas fluid entstehendes, das nicht vorgeplant werden kann. Ich denke, dass Ansätze von „The Art of Hosting and Harvesting“ in Wertschätzung für diese Dialektik noch einen Schritt weiter gehen können, „Grace“ zu erreichen.
Literatur: Will and Grace: An Integrative Dialectic Central to Gestalt Psychotherapy. Sally Denham-Vaughan, erschienen im British Gestalt Journal, 14,1, 2005.
Sinnvoll zusammen wirken


 Raphael Wankelmuth ist seit Sommer Werkstudent in einer größeren Entwicklungsbegleitung bei socius. Er genießt als Politologe sein Praxissemester noch bis Ende Januar und wird anschließend in Heidelberg sein Studium beenden. Neben seinem Studium absolviert er gegenwärtig eine Weiterbildung für systemische Therapie und Beratung.
Raphael Wankelmuth ist seit Sommer Werkstudent in einer größeren Entwicklungsbegleitung bei socius. Er genießt als Politologe sein Praxissemester noch bis Ende Januar und wird anschließend in Heidelberg sein Studium beenden. Neben seinem Studium absolviert er gegenwärtig eine Weiterbildung für systemische Therapie und Beratung.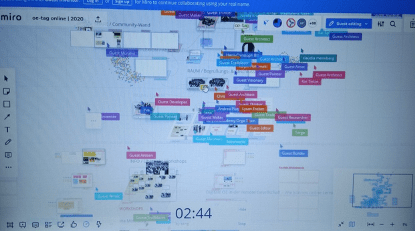
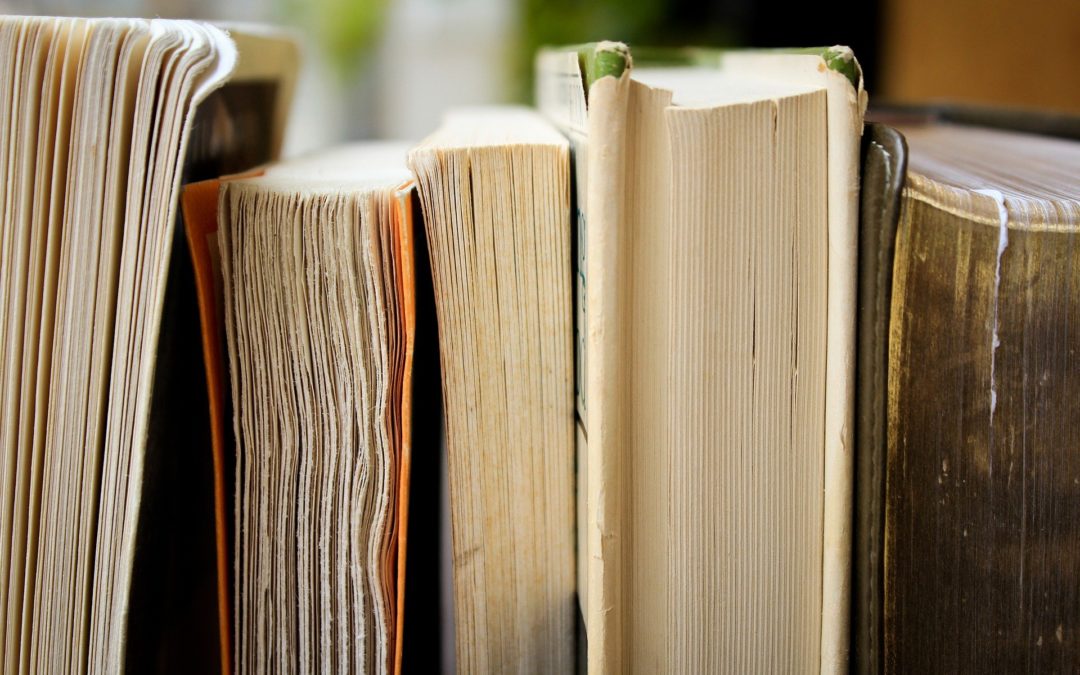
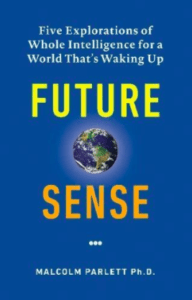 Wir leben in widersprüchlichen Zeiten. 2014 griff Frédéric Laloux ein optimistisches Szenario menschlicher Entwicklung auf und konkretisierte es in „Reinventing Organisations“ zur neuen Qualität der Selbstorganisation – seitdem und vielfach in aller Munde und praktisch unterfüttert durch Erfahrungsansätze von Agilen Formen bis zur Soziokratie. Gleichzeitig erfahren wir Momente überwunden geglaubter autoritärer und abgrenzender Strukturen und Prozesse von der großen Politik (Trump und Brexit) über staatliche Willkür (wie ich zumindest die staatliche Gemeinnützigkeitsdebatte wahrnehme) bis zu wachsendem Rassismus und anderen Formen der Diskriminierung im öffentlichen Raum. Ein „Selbstläufer“ ist die utopische Weltsicht also allemal nicht; vielleicht aber einmal eine Frucht geteilten Er-Lebens und Arbeitens.
Wir leben in widersprüchlichen Zeiten. 2014 griff Frédéric Laloux ein optimistisches Szenario menschlicher Entwicklung auf und konkretisierte es in „Reinventing Organisations“ zur neuen Qualität der Selbstorganisation – seitdem und vielfach in aller Munde und praktisch unterfüttert durch Erfahrungsansätze von Agilen Formen bis zur Soziokratie. Gleichzeitig erfahren wir Momente überwunden geglaubter autoritärer und abgrenzender Strukturen und Prozesse von der großen Politik (Trump und Brexit) über staatliche Willkür (wie ich zumindest die staatliche Gemeinnützigkeitsdebatte wahrnehme) bis zu wachsendem Rassismus und anderen Formen der Diskriminierung im öffentlichen Raum. Ein „Selbstläufer“ ist die utopische Weltsicht also allemal nicht; vielleicht aber einmal eine Frucht geteilten Er-Lebens und Arbeitens.