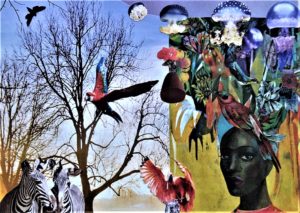Ein Bad im Feminismus des 21. Jahrhunderts
 Mitte Oktober war ich beim “Female Future Force Day” von edition F. Im Berliner Congress Center (bcc) direkt am Alex trafen sich ca. 1000 Frauen* und auch einige Männer*, um sich einen Tag dem Motto “Bridge the Gap” zu widmen.
Mitte Oktober war ich beim “Female Future Force Day” von edition F. Im Berliner Congress Center (bcc) direkt am Alex trafen sich ca. 1000 Frauen* und auch einige Männer*, um sich einen Tag dem Motto “Bridge the Gap” zu widmen.
Für mich war es – wie letztes Jahr auch schon – ein Bad im Feminismus des 21. Jahrhunderts. Es hat mich beschwingt, inspiriert und hoffnungsfroh gestimmt mit so vielen Menschen an einem Ort zu sein, die fröhlich, konzentriert, zugewandt und neugierig anregende Panels und lebendige Masterclasses gestalten und so jede Menge Anlässe kreieren miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ein besonderes Highlight des Tages war sicher das einstündige Gespräch von Annalena Baerbock und Julia Becker, der Verlegerin der Funke Mediengruppe. Ich habe die Außenministerin im Laufe ihrer Amtszeit und in den zahlreichen Fernsehinterviews und Statements nie so lebendig, nahbar, klar, laut, klug, glaubwürdig, verletzlich und #bezaubernd erlebt wie an diesem 12. Oktober. Es war ein Genuss, den beiden Frauen lauschen zu können. Ganz besonders Frau Baerbocks Bemerkung zur Bedeutung der Streichung des § 218 aus dem Strafgesetzbuch hat mich sehr berührt. Dass die Einmischung des Staates in weibliche Körper ein Ende haben muss, ist eine Forderung, deren Umsetzung in unmittelbarer Zukunft langfristige Auswirkungen auf die Menschlichkeit unseres Zusammenlebens haben wird.
Gleichzeitig waren an diesem Tag so viel mehr kluge, nahbare, glaubwürdige, kompetente Menschen aktiv, dass dass ich auch davon noch ein bißchen berichten will:
In Bezug auf meine Arbeit bei SOCIUS haben mich vor allem Fragen nach der gelingenden Schaffung resilienzstärkender und inklusiver Arbeitssettings interessiert. Hier waren die Panels “Bridge the Health Gap – Wie der Umgang mit den Wechseljahren zeigt, was in der Frauengesundheit schief läuft” und “Neurodiversität – ADHS, Autismus, Hochsensibilität und wie uns das Wissen über die Gehirne empowert” für mich besonders lehrreich.
 Gelernt habe ich, dass die Befassung mit den Wechseljahren einer Frau im Medizinstudium genauso wenig vorkommt wie das Erlernen schwangerschaftsbeendender Eingriffe. Oder wie Miriam Yung Min Stein, die Initiatorin der Kampagne “Wir sind 9 Millionen!” es formulierte: “Die Wechseljahre sind vollkommen unterforscht. Wir wissen darüber viel zu wenig!”. Nur eine Woche später war sie im Bundestag als Expertin zur Debatte zur nationalen Strategie für die Menopause eingeladen. Ein Erfolg der Kampagne.
Gelernt habe ich, dass die Befassung mit den Wechseljahren einer Frau im Medizinstudium genauso wenig vorkommt wie das Erlernen schwangerschaftsbeendender Eingriffe. Oder wie Miriam Yung Min Stein, die Initiatorin der Kampagne “Wir sind 9 Millionen!” es formulierte: “Die Wechseljahre sind vollkommen unterforscht. Wir wissen darüber viel zu wenig!”. Nur eine Woche später war sie im Bundestag als Expertin zur Debatte zur nationalen Strategie für die Menopause eingeladen. Ein Erfolg der Kampagne.
Im Panel zur Neurodiversität habe ich von Katharina Schön, Bestsellerautorin, Aktivistin und Beraterin mit AD(H)S, Autismus und Hochbegabung die eingängigste Unterscheidung von Neurodiversität und Neurodivergenz gehört, die mir bislang begegnet ist:
Neurodiversität bezeichnet ungefähr analog zur Biodiversität die Verschiedenheit unserer Gehirne. Diese haben alle jeweils sehr unterschiedliche Ausprägungen, “Verschaltungen” und auch Begabungen. So wie wir es in Flora und Fauna auch allenthalben finden: Es gibt überall Unterschiede.
Von Neurodivergenz jedoch spricht Katharina Schön, wenn es Abweichungen von der Mehrheit diverser Gehirne gibt, die ihre Besitzer*innen mit den Anforderungen des Alltags der Mehrheitsgesellschaft kämpfen lassen.
Diese Unterscheidung in den Definitionen hat sogar ihre mit Panelist*innen überrascht und überzeugt.
Auf dem letzten Podium des Tages ging es um “Bridge the Hate Gap – Frauen gegen Hass und Hetze” in dem Anna-Lena von Hodenberg von HateAid zum Schluss den Teilnehmenden und Zuhörenden “Bildet Banden!“ zurief. „Nicht im zersetzenden und gewalttätigen Sinne, sondern im Sinne von Zusammenhalt, Unterstützung, Allyship. Tut euch zusammen, ruft einander im Netz auf den sozialen Plattformen und werdet gemeinsam mutig laut gegen Hass und Hetze!”. Ich habe das sehr gefeiert und mich wohlig an meine Studienzeit in den 90er Jahren erinnert gefühlt, in der genau das auch eines unserer Motti war: Gelebte Solidarität. Ihre Bedeutsamkeit ist bis heute nicht verloren gegangen. Im Gegenteil ist sie im Netz wahrscheinlich noch viel wichtiger geworden, und auch einfacher.
Nächstes Jahr im Oktober findet hoffentlich wieder ein Female Future Force Day statt und ich freu mich schon jetzt wieder dabei zu sein.
Autorin Nicola Kriesel



 Was ist deiner Meinung nach der beste Weg, eine Gesellschaft zu verändern?
Was ist deiner Meinung nach der beste Weg, eine Gesellschaft zu verändern?  Was ist deiner Meinung nach der beste Weg, eine Gesellschaft zu verändern?
Was ist deiner Meinung nach der beste Weg, eine Gesellschaft zu verändern? 

 Seit es den NPO-Sektor gibt, engagieren sich hier Frauen für die unterschiedlichsten Belange, zunehmend auch in Form von Erwerbstätigkeit. Auf die Frage, warum sie für eine NPO arbeite, antwortete eine Frauen-Führungskraft im Rahmen einer
Seit es den NPO-Sektor gibt, engagieren sich hier Frauen für die unterschiedlichsten Belange, zunehmend auch in Form von Erwerbstätigkeit. Auf die Frage, warum sie für eine NPO arbeite, antwortete eine Frauen-Führungskraft im Rahmen einer  Der starke Anteil von Frauen in NPOs auf der Beschäftigtenebene spiegelt sich allerdings nicht auf der Leitungsebene: Die Vorstände sind mehrheitlich von Männern dominiert. Insbesondere auf den Führungsebenen großer, einflussreicher NPOs wie beispielsweise finanzstarker Stiftungen finden sich nur wenige Frauen. Als Faustregel lässt sich formulieren: Je größer, finanzkräftiger und älter eine Organisation ist, desto weniger Frauen bekleiden Spitzenpositionen. Die KZ-Gedenkstätte Dachau bildet in dieser Frage eine Ausnahme: Nicht nur übernahm schon im Zuge der Gründung 1965 eine Frau die Leitung, sondern wird die Leitung bis heute von einer Frau ausgeübt.
Der starke Anteil von Frauen in NPOs auf der Beschäftigtenebene spiegelt sich allerdings nicht auf der Leitungsebene: Die Vorstände sind mehrheitlich von Männern dominiert. Insbesondere auf den Führungsebenen großer, einflussreicher NPOs wie beispielsweise finanzstarker Stiftungen finden sich nur wenige Frauen. Als Faustregel lässt sich formulieren: Je größer, finanzkräftiger und älter eine Organisation ist, desto weniger Frauen bekleiden Spitzenpositionen. Die KZ-Gedenkstätte Dachau bildet in dieser Frage eine Ausnahme: Nicht nur übernahm schon im Zuge der Gründung 1965 eine Frau die Leitung, sondern wird die Leitung bis heute von einer Frau ausgeübt.