
Von der Organisationsentwicklung zur Gesellschaftsentwicklung
Ein gedankliches Experiment
Organisationsentwickler*innen begleiten Organisationen in ihren Entwicklungsprozessen. Doch was, wenn es auch für die Gesellschaft ähnlich begleitete Prozesse gäbe? Was, wenn es Gesellschaftsentwickler*innen gäbe?
Ich möchte uns zu einem Gedankenexperiment einladen.
Unsere Gesellschaft steht vor immensen Herausforderungen, dazu gehören Entwurzelung und ökonomische Ungleichgewichte, der Klimawandel, soziale Isolation und Corona, neben vielen weiteren. Dabei werden die notwendigen Entwicklungsprozesse jedoch in den wenigsten Fällen gezielt begleitet. Viel häufiger geschieht ein Ringen und Verhandeln vieler Akteur*innen aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft usw., häufig mit viel Reibung. Selten kommt es vor, dass die Reibung konstruktiv in eine gemeinsame Entwicklung der involvierten Akteur*innen eingebettet wird. Könnte das nicht anders sein?
Prozessbegleitung der Gesellschaft
 Ähnlich wie eine Organisation hat eine Gesellschaft viele Teil- und Subsysteme (nur weitaus komplexer). Dies können Organisationen sein, aber genauso der Wohnblock um die Ecke, ein Familiensystem, eine Metropole, einzelne Menschen, Bündnisnetzwerke oder ganze Staaten. Gesellschaftsentwickler*innen hätten die Möglichkeit, auf ganz unterschiedlichen Ebenen bzw. in unterschiedlichen Systemen anzusetzen und konzertierte Entwicklungsprozesse darin zu begleiten.
Ähnlich wie eine Organisation hat eine Gesellschaft viele Teil- und Subsysteme (nur weitaus komplexer). Dies können Organisationen sein, aber genauso der Wohnblock um die Ecke, ein Familiensystem, eine Metropole, einzelne Menschen, Bündnisnetzwerke oder ganze Staaten. Gesellschaftsentwickler*innen hätten die Möglichkeit, auf ganz unterschiedlichen Ebenen bzw. in unterschiedlichen Systemen anzusetzen und konzertierte Entwicklungsprozesse darin zu begleiten.
Nehmen wir an, die Auseinandersetzung mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würde als Gesellschaftsentwicklungsprozess aufgesetzt werden. Ausgangslage bzw. Beauftragung wäre die erfolgreiche Petition dazu vom Frühjahr 2020. Solch ein Prozess könnte etwa die Durchführung verschiedener facilitierter Austauschforen beinhalten, in denen Vertreter*innen unterschiedlicher Positionen sich menschlich begegnen können um gemeinsam Synthesen zu erarbeiten. Womöglich würde es sich anbieten, Bürger*innenräte dazu durchzuführen, sowie Prozesse mit Verwaltungen, Kommunen, privatwirtschaftlichen Unternehmen und/oder Branchenverbänden zu initiieren. Gesellschaftsentwickler*innen könnten hier zwischen den Systemen vermitteln, für Öffentlichkeit und Transparenz sorgen und zugleich die Vulnerabilität der Entwicklungsprozesse schützen und Ergebnisse zusammenführen.
Gesellschaftsentwickler*innen bekämen durch die Arbeit in so unterschiedlichen Systemen ein ausgeprägtes Feingefühl, sich auf jeweilige Systemkulturen einzustellen und zwischen ihnen zu übersetzen – dies würde gleichzeitig ein größeres Generalist*innenwissen bzw. -erfahrung als in der Organisationsentwicklung erfordern. Ihre Stärke läge vor allem im Vermitteln und Halten von ganz unterschiedlichen, teilweise verschränkten Prozessen. Umso wirksamer könnten sie sein, wenn sie in einem Moment mit einer Behörde arbeiten, im nächsten mit dem Familiensystem der Behördenleiterin und im dritten mit dem Klientel der Behörde.
Aus den Erkenntnissen der OE schöpfen
Es gibt viele Fälle, in denen OE-ler*innen neben ihrer „klassischen“ Tätigkeit Bürger*innenforen facilitieren, parallel einer therapeutischen Tätigkeit nachgehen und in ihre Arbeit integrieren oder Nachbarschafts- und Kommunalentwicklung begleiten. Wenn wir in den Bereich der Unternehmensberatung schauen, ist es heutzutage Usus, dass Beratungsfirmen Politiker*innen, Ministerien, Staaten usw. beraten. Dabei bleiben die Beratungen jedoch oft im Hintergrund und sind für die Betroffenen der Beratungsinhalte wenig sichtbar. Eine transparente Prozessbegleitung auf gesellschaftlicher Ebene könnte diese Lücke schließen.
Das Potential, aus der Disziplin der Organisationsentwicklung zu schöpfen, ist groß. Es ist sieben Jahre her, dass Frederic Laloux‘ Reinventing Organizations erschien. In dieser kurzen Zeit sind progressive Organisationen bzw. Praktiken aus der Nische getreten und haben einen nicht zu übersehenden Trend erzeugt. Die Nachfrage nach mehr Resilienz, Partizipation, Authentizität, Selbstverantwortung, Herzlichkeit und gesellschaftlicher Verantwortung in Organisationen ist sprunghaft angestiegen (was sicher nicht nur Laloux zu verdanken ist, doch markiert sein Buch diese Trendwende). Dass der Gesellschaft vieles davon zugute kommen könnte, liegt nahe.
Verantwortung für eine schönere Welt
Aus meiner Perspektive betreiben Organisationsentwickler*innen schon vielfach Gesellschaftsentwicklung, sind sich dieser großen Verantwortung aber nicht zwangsläufig bewusst. Das ist bedauerlich. Mehr denn je braucht unsere Gesellschaft Lösungen, die uns aus bestehenden Paradigmen heraushelfen und dringende Entwicklungen voranbringen. Es gibt glücklicherweise schon eine Menge progressiver Lösungen, wenn wir nur anfangen, uns ein wenig umzuschauen. Für einen guten Rundumschlag empfehle ich Zukunft für alle vom Konzeptwerk neue Ökonomie und Utopia 2048 von Lino Zeddies.
 Um solchen Lösungen in die Welt zu helfen und weitere zu entwickeln, braucht es Gesellschaftsentwickler*innen, die neben Prozessbegleitung verheißungsvolle Impulse in die Gesellschaft bringen. Der systemische Blick und Einblick in ausstehende Entwicklungsschritte der Gesellschaft ermöglichen es, hier passende Impulse zu setzen. Beispiele für bisherige konzeptionelle Impulse sind etwa Bürger*innenräte, Reinventing Organizations, das bedingungslose Grundeinkommen, die Gemeinwohlökonomie oder (auf niedrigerer Flughöhe) die beiden eben genannten Publikationen. In unserer Zeit reicht es nicht aus, nur auf das, was sich entwickeln will zu warten. Wir brauchen Impulse, die aktiv in eine schönere Welt einladen. Diese zu setzen wäre ebenso eine genuine Aufgabe von Gesellschaftsentwickler*innen. Mit solch einer Verantwortung geht allerdings genauso ein Bedarf an Kompetenzen einher, wozu ich im nächsten Abschnitt einige Vorschläge vorstelle.
Um solchen Lösungen in die Welt zu helfen und weitere zu entwickeln, braucht es Gesellschaftsentwickler*innen, die neben Prozessbegleitung verheißungsvolle Impulse in die Gesellschaft bringen. Der systemische Blick und Einblick in ausstehende Entwicklungsschritte der Gesellschaft ermöglichen es, hier passende Impulse zu setzen. Beispiele für bisherige konzeptionelle Impulse sind etwa Bürger*innenräte, Reinventing Organizations, das bedingungslose Grundeinkommen, die Gemeinwohlökonomie oder (auf niedrigerer Flughöhe) die beiden eben genannten Publikationen. In unserer Zeit reicht es nicht aus, nur auf das, was sich entwickeln will zu warten. Wir brauchen Impulse, die aktiv in eine schönere Welt einladen. Diese zu setzen wäre ebenso eine genuine Aufgabe von Gesellschaftsentwickler*innen. Mit solch einer Verantwortung geht allerdings genauso ein Bedarf an Kompetenzen einher, wozu ich im nächsten Abschnitt einige Vorschläge vorstelle.
Gesellschaftsentwicklung als Disziplin
Was könnte es konkret bedeuten, Gesellschaftsentwickler*in (GE-ler*in) zu sein? Welche Kompetenzen brauchen Menschen, die solch einer verantwortungsvollen Aufgabe nachgehen? Fünf Bereiche möchte ich dazu vorschlagen, die aus meiner Sicht entscheidend sind.
- Persönlichkeit entwickeln – Ähnlich wie bei der OE ist schon auf dem Weg zur Tätigkeit als Gesellschaftsentwickler*in eine tiefe Auseinandersetzung mit sich selbst, den eigenen Wurzeln und Verletzungen von großer Bedeutung. Um mit Menschen und Systemen in Resonanz gehen zu können, brauchen wir eine innere Geklärtheit und Reife. Wer ständig emotional von anderen aktiviert wird, also starke emotionale Reaktionen erlebt, kann nur schwer in eine fruchtbare Resonanz mit ihnen treten und gemeinsam Entwicklungspotentiale erforschen, respektive den Entwicklungsprozess begleiten. Unbewusst feuernde Ego-Anteile können hier stattdessen Schaden anrichten. Persönliche Entwicklung ist insofern eine Grundvoraussetzung, gerade weil so viel Gestaltungsmacht in den Händen von GE-ler*innen liegt.
- Utopien entwerfen – Was lässt sich alles aus der derzeitigen Corona-Pandemie an Potentialen heben? GE-ler*innen verbinden sich zwar mit der Tragik einer Situation (Resonanz), gehen aber einen Schritt weiter und fokussieren ebenso auf entstehenden Möglichkeiten. Sie stellen sich regelmäßig die Frage „Was ist in diesem Moment das höchste Potential von … z.B. dem Gesundheitssystem?“ So ergründen sie Potentiale, zeigen sie auf und laden ein, Chancen zu ergreifen. Insofern gehört die Fähigkeiten, Potentiale zu erkennen und frei in verschiedene Möglichkeitsrichtungen zu denken zum Repertoire. Mit ihren Gedankenexperimenten treten sie als Musen auf, um Entwicklungen zu inspirieren. Dabei verbinden GE-ler*innen in scheinbarem Widerspruch stehende Elemente und bilden Proto-Synthesen. Es zählt nicht, welche Idee besser ist als die andere, sondern wie sich die Kerne kreativ zusammenfügen lassen, um etwas Größeres zu schaffen. (Das Konzept der Gesellschaftsentwicklung als Disziplin selbst ist eine Proto-Synthese vieler Einflüsse und Konzepte, die mir bisher begegnet sind – es wird sich zeigen, ob es eine hilfreiche Synthese ist und wie sie sich ggf. weiter entwickelt.)
 Beziehungsgeflechte weben – Da es immer unmöglicher wird, von einer einzelnen Warte aus verantwortungsvoll zu intervenieren und mit der uns umgebenden Komplexität umzugehen, brauchen wir die Unterstützung und Perspektiven anderer. Mit fundierter Multiperspektivität können GE-ler*innen adäquat agieren. Zweitens sind Gesellschaften selbst zu großen Teilen ein hyperkomplexes Beziehungsgeflecht. Diese Beziehungen werden ständig aktualisiert und in ihrer Qualität verändert – entsprechend auch das gesamte Geflecht, also die Gesellschaft. Durch das bewusste Gestalten von Beziehungen und Beziehungsgeflechten, prägen GE-ler*innen unmittelbar die Muster unserer Gesellschaft. Sie können entscheiden, wie engmaschig, bunt oder tragend Netze gewoben sind – darüber entwickeln sie Gesellschaft.
Beziehungsgeflechte weben – Da es immer unmöglicher wird, von einer einzelnen Warte aus verantwortungsvoll zu intervenieren und mit der uns umgebenden Komplexität umzugehen, brauchen wir die Unterstützung und Perspektiven anderer. Mit fundierter Multiperspektivität können GE-ler*innen adäquat agieren. Zweitens sind Gesellschaften selbst zu großen Teilen ein hyperkomplexes Beziehungsgeflecht. Diese Beziehungen werden ständig aktualisiert und in ihrer Qualität verändert – entsprechend auch das gesamte Geflecht, also die Gesellschaft. Durch das bewusste Gestalten von Beziehungen und Beziehungsgeflechten, prägen GE-ler*innen unmittelbar die Muster unserer Gesellschaft. Sie können entscheiden, wie engmaschig, bunt oder tragend Netze gewoben sind – darüber entwickeln sie Gesellschaft.
- Veränderung vorleben – Um in ein anderes Miteinander unserer Gesellschaft zu treten, braucht es Pionier*innen, die durch eigenes Experimentieren und Vorleben Eindrücke dessen transportieren können, was alles möglich ist und wünschenswert sein kann. Als immanenter Teil der gesellschaftlichen Systeme sind wir gefragt, mit den denkbaren Grenzen zu spielen, das scheinbar Unmachbare zu testen und Wege zu begehen, die visionär, reizvoll und einladend sind. Das gilt für unsere individuelle Ebene (wie gestalten wir Freundschaften und Liebe, wie gehen wir mit unserer Nachbarschaft und unserer Umwelt um, wie gehen wir mit unserem Geld um etc.?), es gilt für unsere organisationalen Ebenen (nach welchen Prinzipien organisieren wir uns, wie werden hier Beziehungen gepflegt, welchen Umgang mit Zeit, Stress, Geld, Macht und Inspiration wollen wir hier leben?) und für die gesellschaftlichen Ebenen (wie bringen wir uns bei den großen Themen ein, welches Geschenk haben wir unseren Mitmenschen zu geben, was haben wir der Welt anzubieten?).
- Prozesse begleiten – Entwicklungen vollziehen sich in Prozessen. Ähnlich wie Kinder Begleitung in ihrer Entwicklung brauchen, bis sie auf eigenen Beinen stehen, können auch Systeme Entwicklungsbegleitung gut gebrauchen. Gesellschaftsentwickler*innen begleiten Prozesse unterschiedlicher Systeme. Diese können einzelne Menschen sein, ein Team, eine Familie, eine Organisation, eine Institution, eine Gemeinde, eine Subkultur, ein organisationales Netzwerk, ein Staat, ein Staatenbund oder ein supranationales Netzwerk. Dabei achten sie auf Wechselwirkungen der Systeme und wechseln wo sinnvoll die Systemebene. GE-ler*innen halten einen Rahmen, in dem sich ein System entwickeln kann. Sie achten darauf, was das System selbst entwickeln möchte und machen in Resonanz damit entsprechende Angebote zum gemeinsamen Explorieren. Für die Prozessbegleitung brauchen sie den entsprechenden Methodenkoffer, der speziell für Gesellschaftsentwicklung teilweise noch zu entwickeln wäre.
Wenn ich Gesellschaftsentwickler*in wäre …
Unsere Welt braucht mehr denn je die Kraft aller, damit wir es hinbekommen, eine neue Geschichte der Verbundenheit statt der Trennung (das dominante Paradigma des 20. Jahrhunderts) zu schreiben. Durch die Komplexität unserer Welt brauchen wir gleichzeitig Menschen, die sich in vielen Bereichen auskennen und sich auf das Begleiten von Entwicklungsprozessen verstehen. Gesellschaftsentwicklung kann ein Weg sein, der es wert ist, weiter erforscht zu werden. Auf diesem Weg werden wir uns unserer schon vorhandenen Gestaltungsmacht bewusster und können sie entsprechend bewusster einsetzen. Fangen wir damit an, uns die Frage zu stellen: „Wenn ich Gesellschaftsentwickler*in wäre – was würde (s)ich ändern?“
Weiterführende Literatur
Über neue Formen gesellschaftlichen Wirkens
Eisenstein, Charles (2017): Die schönere Welt, die unser Herz kennt, ist möglich
Freinacht, Hanzi (2017; 2019): The Listening Society und Nordic Ideology
Dietrich, Wolfgang (2011): Variationen über die vielen Frieden Band 2: Elicitive Konflikttransformation und die transrationale Wende in der Friedenspolitik
Über konkrete Ideen, es anders zu machen
Konzeptwerk neue Ökonomie (2020): Zukunft für alle – Eine Vision für 2048
Zeddies, Lino (2020): Utopia 2048
Laloux, Frederic (2014): Reinventing Organizations
Quellen Bilder
Singapur Utopia 2048, BY AERROSCAPE, CREATIVE COMMONS LIZENZ: CC BY-NC-SA
Landleben Utopia 2048, BY AERROSCAPE, CREATIVE COMMONS LIZENZ: CC BY-NC-SA
Earth College UTOPIA 2048, BY AERROSCAPE, CREATIVE COMMONS LIZENZ: CC BY-NC-SA
Sinnvoll zusammen wirken


 Raphael Wankelmuth ist seit Sommer Werkstudent in einer größeren Entwicklungsbegleitung bei socius. Er genießt als Politologe sein Praxissemester noch bis Ende Januar und wird anschließend in Heidelberg sein Studium beenden. Neben seinem Studium absolviert er gegenwärtig eine Weiterbildung für systemische Therapie und Beratung.
Raphael Wankelmuth ist seit Sommer Werkstudent in einer größeren Entwicklungsbegleitung bei socius. Er genießt als Politologe sein Praxissemester noch bis Ende Januar und wird anschließend in Heidelberg sein Studium beenden. Neben seinem Studium absolviert er gegenwärtig eine Weiterbildung für systemische Therapie und Beratung.
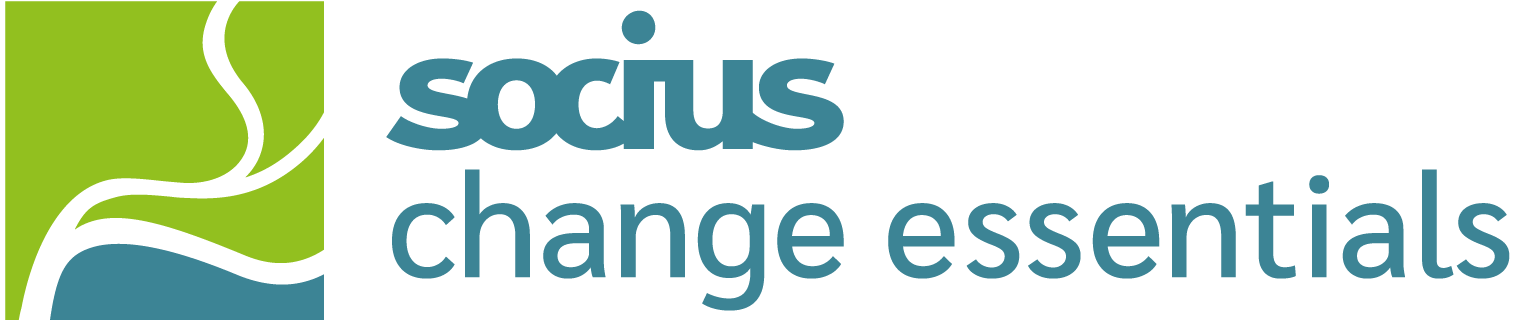



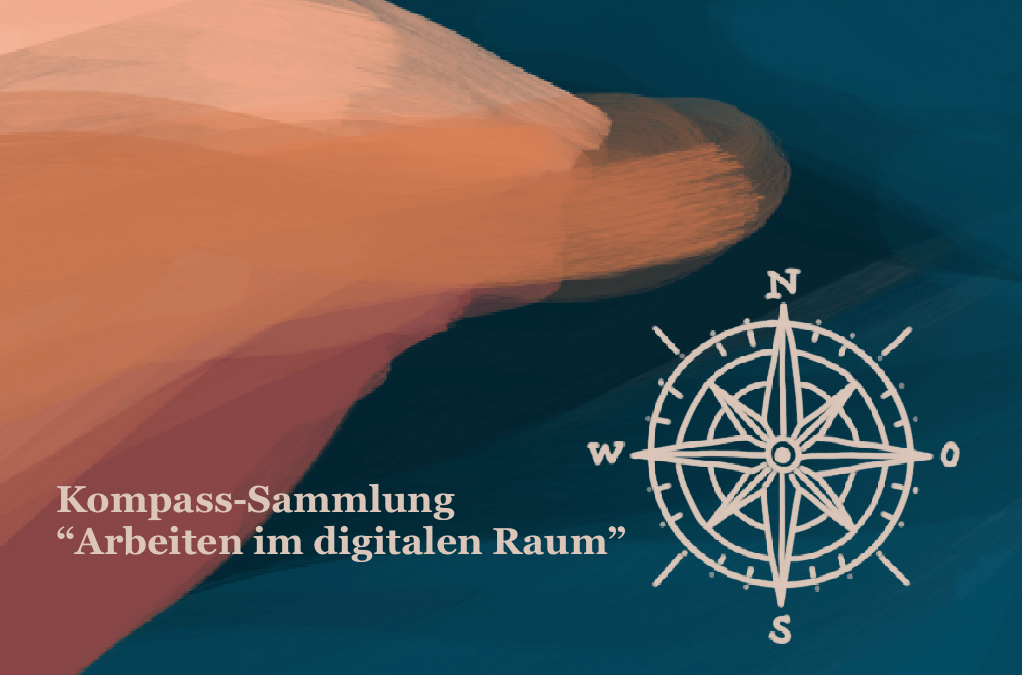


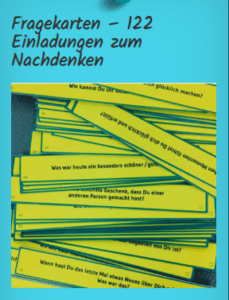



 Im Homeoffice ist es wichtig für Bewegung zu sorgen. Ich nutze z.B. einen Fokus-Timer, d.h. ich sortiere meine Tagesaufgaben morgens in 5-Minuten-Aufgaben und andere. Dann priorisiere ich die anderen und fange an zu arbeiten. 25 Minuten. Dann mache ich 5 Minuten Pause. Stehe auf. Geh auf die Toilette. Koche Tee. Tanze. Wasauchimmer. Dann wieder 25 Minuten. 5 Minuten Pause. Das Ganze noch 2 Mal. Dann 15 – 20 Minuten Pause. Wenn ich in einem 25 Minuten Turnus mit einer Aufgabe fertig werde, aber keine Lust/Zeit habe eine andere größere Aufgabe anzufangen, erledige ich eine der identifizierten 5-minuten Aufgaben.
Im Homeoffice ist es wichtig für Bewegung zu sorgen. Ich nutze z.B. einen Fokus-Timer, d.h. ich sortiere meine Tagesaufgaben morgens in 5-Minuten-Aufgaben und andere. Dann priorisiere ich die anderen und fange an zu arbeiten. 25 Minuten. Dann mache ich 5 Minuten Pause. Stehe auf. Geh auf die Toilette. Koche Tee. Tanze. Wasauchimmer. Dann wieder 25 Minuten. 5 Minuten Pause. Das Ganze noch 2 Mal. Dann 15 – 20 Minuten Pause. Wenn ich in einem 25 Minuten Turnus mit einer Aufgabe fertig werde, aber keine Lust/Zeit habe eine andere größere Aufgabe anzufangen, erledige ich eine der identifizierten 5-minuten Aufgaben.

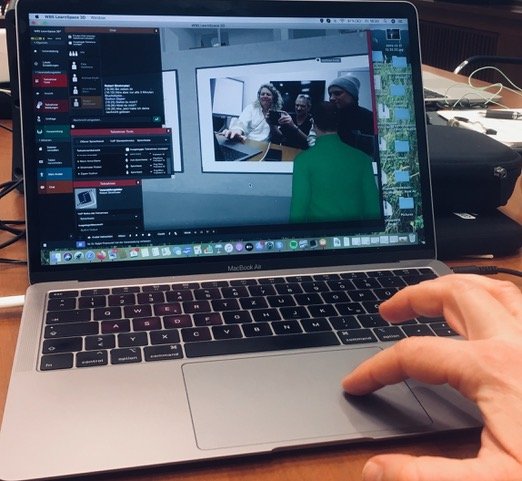


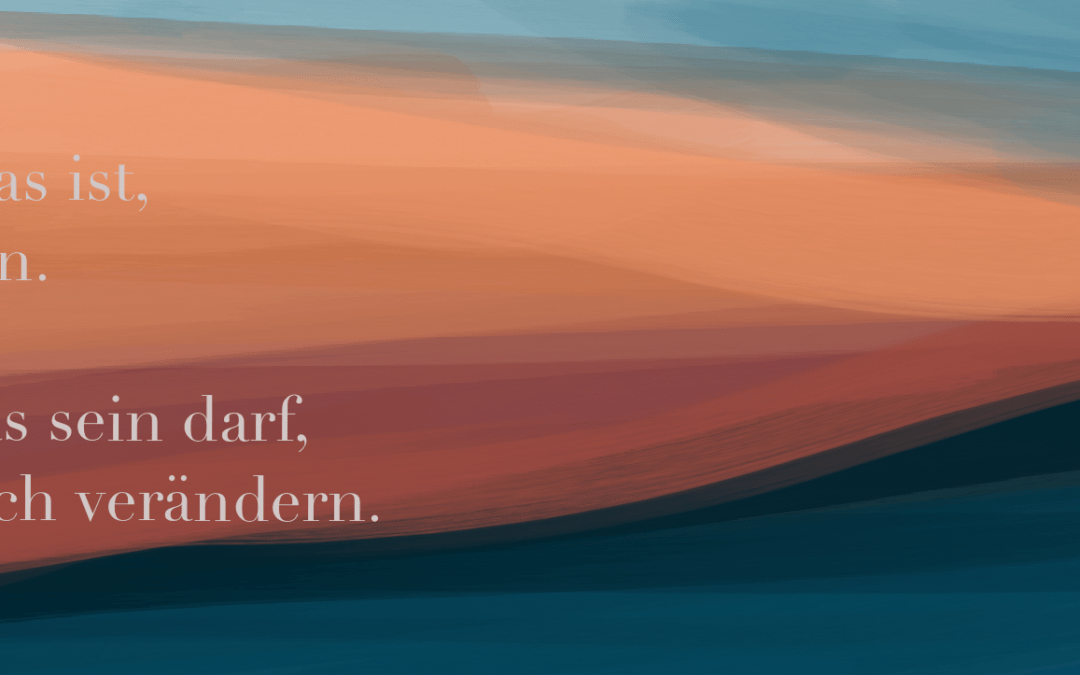

 Die
Die 













